Wer erwartet hätte, dass Europas Spitzen eine echte Analyse nach dem Brexit hätten, irrt gewaltig. Phrasen um Phrasen, die ewig gleiche Terminologie – alles außer eine echte Auseinandersetzung mit Europa ist am Freitag bemerkbar.
Highlight dieser intellektuellen Ergüsse ist zweifellos EU-Ratspräsident Donald Tusks Binsenwahrheit: „Was uns nicht umbringt, macht uns stärker.“ Puh. Selbst ein überzeugter Europäer kann sich bei derart Oberflächlichem nur wundern.
Politikverdrossenheit? Selbst Schuld!
Man möchte Herrn Tusk antworten: „Ein klein wenig Politikverdrossenheit hängt genau mit dieser Art von Wischiwaschi-Statement zusammen.“ Aber es wäre zu einfach, die Reaktionen auf den Brexit auf die üblichen Phrasen zu reduzieren.
Selbst wenn die Form der Reaktionen banal ist, dürfte man davon ausgehen, dass inhaltlich mehr zum Ausdruck kommt. Weit gefehlt. Es wirkt fast so, als hätte das politische Europa sich nicht im Traum ausmalen können, dass die Briten „Goodbye“ sagen. Selbst wenn der Brexit mit den parteiinternen Spielereien von Noch-Premier David Cameron begonnen hat, ist der wachsende Euroskeptizismus in verschiedenen Gesellschaftsteilen Europas nicht von der Hand zu weisen. Er wird durch solche Phrasen nur befeuert.
Post-Brexit-was?
Wendet man den Blick auf die Inhalte, ergibt sich ein verstörendes Bild. Großbritannien ist nach dem Brexit tief gespalten. Das „fifty fifty“-Ergebnis spiegelt die Zerrissenheit Europas wieder. Dass es noch keine Post-Brexit-Vision gibt, hängt hiermit eng zusammen. Das krampfhafte Festhalten am Glauben, es käme am Ende dann doch nicht so schlimm, mag Teil der Taktik der EU-Granden um Jean-Claude Juncker und co. gewesen sein.
Das Ausbleiben einer Post-Brexit-Vision ist aber mindestens genauso sehr der Tatsache verschuldet, dass die in der EU zurückbleibenden Schwergewichte Deutschland und Frankreich immer noch keine gemeinsame Europa-Politik gestalten. Es wird verwaltet, reagiert und „gebetet“. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 ist die Gestaltungskraft der europäischen Politik gen null gesunken.
Öffentliche Auftritte für die Form
Daran können noch so viele gemeinsame öffentliche Auftritte an historischen Gedenkstätten nichts ändern: Angela Merkel und François Hollande haben als Antriebsmotor der europäischen Integration versagt. Die deutsche Kanzlerin tut dies etwa, indem sie seit Jahren Probleme aussitzt. Hollande hat sich außenpolitisch vor allem durch sein kriegerisches „Talent“ unter Beweis gestellt…
Dass Rechtspopulisten ihnen das Leben nicht gerade einfacher gemacht haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Allerdings ist das Gegenargument mindestens genauso überzeugend: Politiker wie Hollande und Merkel haben es Populisten durch ihre wenig abgestimmte Europa-Politik erst so einfach gemacht. Der gemeinsame Kompass fehlt.
Grexit, anyone?
Dies zeigte sich nicht zuletzt bei einem Ereignis, das gerade mal ein Jahr zurückliegt. Erinnert sich noch jemand an die brutalen Grexit-Diskussionen? Hier trafen – ausgetragen auf dem Rücken der Griechen – zwei europapolitische Visionen aufeinander, die nicht unterschiedlicher hätten sein können.
Austeritäts- versus Investitionspolitik, gemeinsame Fiskalpolitik versus Steuerautonomie: der „Grexit“ wurde vermieden, allerdings zeigten sich bereits die tiefen Risse zwischen der deutschen und der französischen Europapolitik. Der „Brexit“ ist nun die logische Konsequenz. Zu lange ließ man sich auf die Erpressung von David Cameron ein.
Anti-EU-Rhetorik
Man möchte nicht allen britischen Wählern unterstellen, sie würden irrational handeln. Allerdings sind angesichts der erschlagenden Argumente, die für einen Verbleib in der EU sprechen, andere Kräfte am Wirken: Die Abneigung gegen Brüssel ist ein Amalgam aus berechtigter Kritik, Halbwissen – und das Resultat der langjährigen Anti-EU-Rhetorik vieler britischer Politiker.
Was das alles mit Merkel und Hollande zu tun hat? Sie haben sich nicht stark genug von dieser Art EU-Bashing distanziert. Die deutsche Bundeskanzlerin toleriert selbst jemanden wie den ungarischen Ministerpräsident, Viktor „Diktator“ Orban, in der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP). Da wirkt jemand wie Cameron im Vergleich fast niedlich.
Cameron, der Stänkernde
Allerdings ist es genau der gleiche Cameron, der lange Zeit vehement gegen die EU gestänkert hat – sich aber aus wahltaktischen Gründen während den Brexit-Debatten als Über-Europäer inszenieren musste. Das Resultat ist bekannt. Cameron wird sich voraussichtlich im Oktober verabschieden, seinen Job los sein, seine Partei nicht geeint haben und die EU mit einem Scherbenhaufen zurücklassen. Appeasement in Sachen Anti-EU-Politik stellt sich als Schuss in den Ofen heraus.
Gerade deswegen wäre das Führungsduo Merkel-Hollande jetzt gefragt. Es geht um mehr als nur die üblichen „Jetzt müssen wir geeint handeln“-Phrasen. Es geht darum, Zuversicht zu vermitteln. Europäische Zukunftsvisionen und Reformen sollten an oberster Stelle stehen.
„What’s next, Brits?“
Aber seien wir mal ehrlich: Merkel wollte die Griechen vor einem Jahr gemeinsam mit ihrem Finanzminister Wolfgang Schäuble aus der EU verbannen. Nun sitzen die Syriza-Dissidenten mit am Tisch, wenn es heißt: „What’s next, Brits?“. Absurder kann der Aufbruch in eine neue europäische Zukunft kaum sein. Niemand sollte sich nur eine Sekunde vormachen, dass die 27 verbliebenen EU-Mitgliedsstaaten auch nur annähernd eine gemeinsame Europa-Vision haben.
„Es gibt nichts drumherum zu reden, der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa, er ist ein Einschnitt für den europäischen Einigungsprozess“, meinte Merkel am Freitagmorgen. Mit Verlaub: Der Brexit ist mehr als ein Einschnitt. Er ist Katastrophe und Chance zugleich.
Erpressungspolitik beenden
Er ist der Moment, sich von der britischen Erpressungspolitik in Sachen Europa zu befreien. Er ist der Moment, Europa neu zu definieren. Er ist der Moment, den Juncker-Plan mit seinen Investitionsgeldern in soziale Projekte fließen zu lassen. Und er ist nicht zuletzt der Moment, mit halbherzigen, improvisierten europäischen Projekten aufzuhören.
Nationale Souveränität oder europäische Solidarität? Eine Vertiefung der Eurozone oder Aufbruch zu einem Europa der zwei Geschwindigkeiten? Ultra-neoliberale Finanzpolitik à la Schäuble oder eine Finanz- und Wirtschaftspolitik, die endlich den Bürgern die Ängste nimmt? Soziale Verrohung oder Populisten mit überzeugenden Argumenten den Wind aus den Segeln nehmen?
Richtige Antworten brauchen richtige Fragen
„Die Europäische Union ist stark genug, um die richtigen Antworten auf den heutigen Tag zu geben“, philosophierte Merkel am Freitag. Um die richtigen Antworten zu geben, müssen zunächst die richtigen Fragen gestellt werden. Hoffentlich stellt sich Europa und allen voran das Duo Merkel-Hollande in Frage.

 De Maart
De Maart







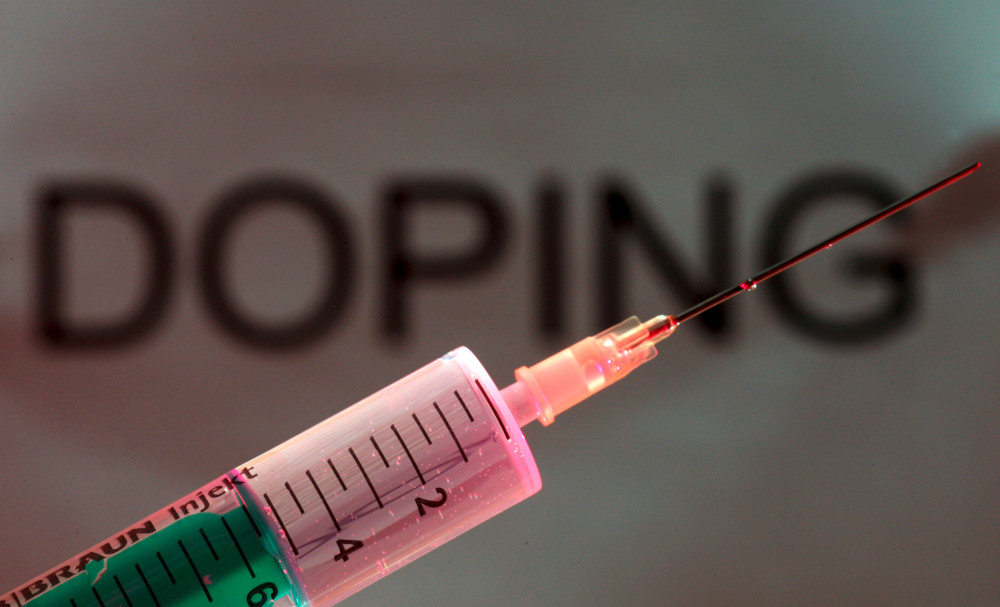
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können