Heute vor einem Jahr wurde Barack Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Ein Tag, der nicht nur deshalb in die Geschichte einging, weil mit ihm der erste Schwarze ins Weiße Haus einzog. Mit der Wahl Obamas endete auch die Finsternis der Bush-Jahre. Acht Jahre, während jener George W. Bush versuchte, das Recht des Stärkeren zum Fundament der internationalen Beziehungen zu machen.
George W. Bushs Überfall auf den Irak kostete Zehntausende Unschuldige das Leben. Seine Nahost-Politik erschöpfte sich in erster Linie in einseitiger Parteinahme zugunsten der Israelis. Was für die Palästinenser bedeutete: noch mehr Leid, noch mehr Demütigungen.
George W. Bush tat sein Allerbestes, um weltweit das Bild des hässlichen Amerikaners zu fördern. Selbst wenn Bush sich eine Außenministerin leistete, die ganz ordentlich Klavier spielen kann, so steht seine Ära doch im Wesentlichen für Gewaltvernarrtheit, Borniertheit und Primitivität.
Dass vor diesem Hintergrund Barack Obama vielen Bürgern dieser Welt geradezu wie ein Erlöser erscheint, kann einen da kaum noch wundern.
Enorme Erwartungen
Und um die enormen Erwartungen, die dergestalt an ihn gestellt werden, erfüllen zu können, müsste er tatsächlich schon eine Art Heiland sein.
Was er natürlich nicht ist: Enttäuschungen, sehr tiefe sogar, sind demnach vorprogrammiert, wenn man es ihm gegenüber an Augenmaß und Realismus fehlen lässt.
Die Verleihung des Friedensnobelpreises hat den Druck auf Obama sogar noch erhöht. Und doch lässt sich diese Auszeichnung durchaus als eine Ermutigung an den jungen Präsidenten verstehen. Eine Solidaritätserklärung.
Denn es ist ja nun nicht so, dass die paläokonservativen Republikaner, welche die Partei immer stärker dominieren, ihre Niederlage vor einem Jahr dazu genutzt hätten, die acht Jahre, während denen sie an der Macht waren, kritisch zu hinterfragen.
Im Gegenteil, die radikale Rechte, die in den USA leider zum politischen Mainstream gehört, überschüttet den neuen Präsidenten tagaus, tagein mit Kübeln von Hass und Missgunst.
Auf die Frage, was er sich vom neuen Staatschef erhoffe, fiel dem beliebten Radiofascho Rush Limbaugh nichts Gescheiteres ein als „dass er scheitert!“. Traurige Gesellen fürwahr. Aber unverändert brandgefährlich.
„You can’t petition the Lord with prayers“ – Jim Morrison wusste, wovon er redete. Dabei könnte Obama jede erdenkliche Fürbitte – wenn sie denn nur hülfe – gebrauchen, angesichts all dessen, was seine talibanesken, palinoiden Gegner im Schilde führen, um zu vereiteln, dass die USA unter seiner Führung ein Quäntchen solidarischer, einen Deut aufgeklärter und zivilisierter werden.
Daran kann es keinen Zweifel geben: Die größten Herausforderungen dieser Zeit, wie z.B. der Dschihadismus (jedweder Religion) oder der Klimawandel, können ohne die aktive Beteiligung der Vereinigten Staaten nicht bewältigt werden.
Und deshalb hat die ganze Menschheit ein Interesse daran, dass er nicht scheitert.





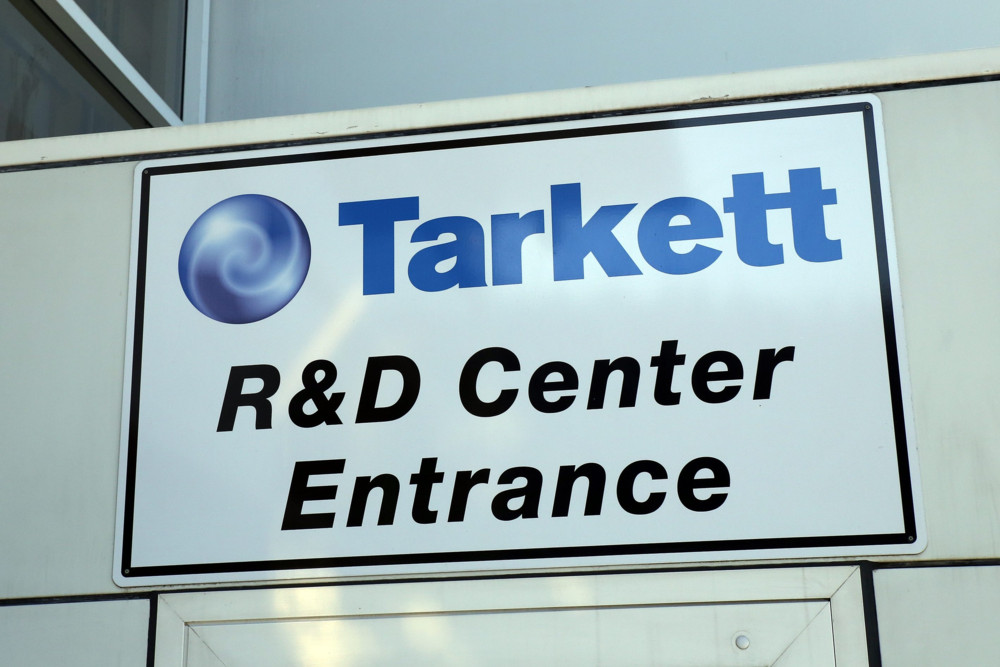


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können