Die Türkei-Vereinbarung ist das Vorbild: Brüssel schlägt Partnerschaften mit Herkunfts- und Transitstaaten von Migranten vor. Ländern, die dabei mitmachen, sollen Vorteile winken – der Rest muss mit „negativen Konsequenzen“ rechnen. Der DPA liegt ein Entwurf des Papiers vor. Die Pläne im Detail:
Warum jetzt diese Vorschläge – die Flüchtlingszahlen sind doch gesunken?
Es gibt die Sorge in Europa, dass viele weitere Menschen aus arabischen und afrikanischen Ländern auf der Flucht vor Verfolgung, Elend und Armut hierherkommen könnten. „Berichte legen nahe, dass Zehntausende Migranten heute in Libyen sind, die nach Wegen suchen, um in die EU zu gelangen“, heißt es im Entwurf des Papiers der EU-Kommission. „Die Ankunftszahlen steigen jeden Tag.“ Das Ziel der EU ist, dass mehr Migranten in Herkunfts- und Transitländer zurückgebracht werden.
Wie sollen diese Partnerschaften funktionieren?
Mit Druck und Anreizen. Die Beziehungen eines Landes zur EU sollen geleitet werden „von der Fähigkeit und dem Willen des Landes, bei der Migrationssteuerung zu kooperieren“, heißt es in dem Papier. Länder, die eigene Staatsbürger aus der EU zurücknehmen oder Flüchtlinge aufnehmen, können eher auf europäische Entwicklungshilfe und vorteilhafte Handelsbeziehungen hoffen als die, die dies nicht tun. „Es muss Konsequenzen geben für jene, die sich weigern, bei der Wiederaufnahme und Rückführung zu kooperieren“, schreibt die EU-Kommission. Es geht auch um den Kampf gegen Menschenschmuggel.
Um welche Länder geht es?
Die EU-Kommission nimmt zunächst vor allem afrikanische und arabische Staaten in den Blick. In dem Entwurf ist die Rede von Jordanien, Libanon, Tunesien, Nigeria, Senegal, Mali, Niger, Äthiopien und Libyen.
Warum der Druck?
Die Zusammenarbeit mit Drittländern läuft nur schleppend. Insbesondere bei Rückführung und der Wiederaufnahme von Migranten habe es keine echte Verbesserung gegeben, beklagt die EU-Kommission. „Die Nachricht, dass Migrationsfragen jetzt oben auf der Prioritätenliste der EU-Außenbeziehungen stehen“, sei von Partnerländern noch nicht recht „gewürdigt“ worden.
Warum ist das so schwierig?
Nachbarländer Syriens wie Libanon und Jordanien haben bereits mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Die nordafrikanischen Maghreb-Staaten weigern sich oft, Migranten zurückzunehmen, weil Dokumente fehlen oder sie die Staatsbürgerschaft als unklar einstufen. Und im krisengeschüttelten Mali fehlt es etwa an Strukturen zur Wiederaufnahme und Eingliederung von Rückkehrern.
Was soll das Ganze kosten?
Etwa acht Milliarden Euro will die EU-Kommission bis 2020 aus bestehenden Töpfen für Migrationspartnerschaften abzweigen, wie EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos der Zeitung „Die Welt“ sagte. Im Herbst will die Brüsseler Behörde einen Investitionsplan vorstellen. Wenn sich die EU-Staaten und andere beteiligen, „könnten am Ende sogar Investitionen von bis zu 62 Milliarden Euro mobilisiert werden“, meint Avramopoulos.
Ob das klappt, bleibt abzuwarten. Der Chef der konservativen und christdemokratischen Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, beklagt, dass die EU-Staaten bisher kaum Geld in den längst vereinbarten Afrika-Nothilfefonds gezahlt haben. Die Mittel sollen helfen, Fluchtursachen wie Armut zu bekämpfen. „Leider bekommt man den Eindruck, dass die EU-Staaten immer noch meinen, sich im Schongang durch die Migrationskrise durchlavieren zu können“, so Weber.
Ist das eine neue Idee?
Nicht so ganz. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben die EU-Kommission und die EU-Außenbeauftragte bereits im Oktober aufgefordert, „maßgeschneiderte Anreizmaßnahmen für Drittländer“ vorzuschlagen. „Es gilt (…), die Hebelwirkung im Bereich der Rückkehr/Rückführung und Rückübernahme weiter zu steigern, gegebenenfalls unter Anwendung des Grundsatzes «mehr für mehr»“, heißt es in der Gipfelerklärung. Die Formel „mehr für mehr“ bedeutet, dass kooperative Staaten sich bessere Beziehungen zur Europäischen Union erhoffen können.

 De Maart
De Maart






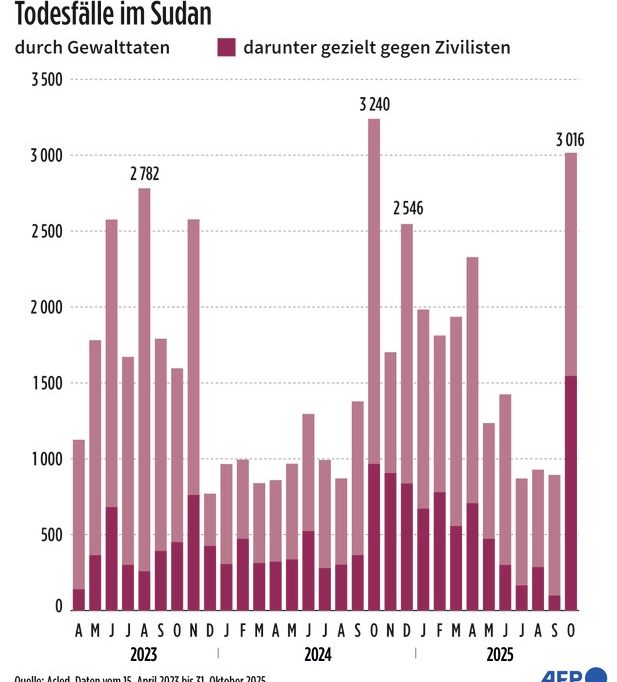
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können