Ein Land ist (kriegs-)müde. Nach zwei in vielerlei Hinsicht verlustreichen Waffengängen hat sich die Ernüchterung breitgemacht. Die meisten Amerikaner würden Afghanistan und den Irak lieber gestern als heute verlassen – von der hurrapatriotischen Stimmung nach dem 11. September 2001 ist wenig geblieben. Der Rückzug ist eingeleitet, die Bilanz ist gelinde gesagt durchzogen: Die beiden Länder sind von stabilen Verhältnissen weit entfernt.
Es erstaunt daher kaum, dass sich die Lust auf weitere außenpolitische Abenteuer in engen Grenzen hält. Denn was nach Jahrzehnten, in denen sich die USA in zahlreiche Konflikte eingemischt haben, fast in Vergessenheit geriet: Die Amerikaner sind von ihrem Naturell her keineswegs eine kriegslüsterne Welteroberer-Nation. Sie neigen im Gegenteil dazu, sich vom Rest der Welt abzuschotten. „Während der meisten Zeit ihrer Geschichte war die Republik in der Außenpolitik isolationistisch eingestellt“, hielt der renommierte Historiker Arthur Schlesinger, einst Mitarbeiter der Regierung von John F. Kennedy, in einer Rede 1995 fest.
Wirtschaftlich auf Expansion eingestellt
Seit der Unabhängigkeit sei das Land darauf bedacht gewesen, sich von ausländischen Verwicklungen und Streitigkeiten fernzuhalten, sagte Schlesinger. Schon George Washington, Sieger im Unabhängigkeitskrieg und erster US-Präsident, ermahnte seine Landsleute, „sich von permanenten Allianzen fernzuhalten“. Präsident James Monroe formulierte 1823 die nach ihm benannte Doktrin: Darin verwahrte er sich gegen ein Eindringen Europas in die Einflusssphäre der USA, zu der er auch Lateinamerika zählte. Im Gegenzug gelobte Monroe, Amerika werde sich nicht in europäische Konflikte einmischen.
Im 19. Jahrhundert hielten sich die USA weitgehend daran – mit einer Ausnahme: „Wenn es um Handel ging, waren die Vereinigten Staaten nie isolationistisch“, so Arthur Schlesinger. So sorgten amerikanische Kriegsschiffe 1867 mit mehr oder weniger sanftem Druck dafür, dass sich das abgeschottete Japan der Welt – und amerikanischen Waren – öffnete. Wirtschaftliche Expansion und aussenpolitische Isolation waren damals kein Widerspruch.
Woodrow Wilsons Kehrtwende
Im Zeitalter des Imperialismus um die Wende zum 20. Jahrhundert wurden auch die USA auf der Weltbühne aktiv. Sie unterstützten mit Waffengewalt die Loslösung Kubas und der Philippinen von Spanien, annektierten mehrere Pazifikinseln (Guam, Samoa) und den Panama-Kanal. Doch als die beiden Weltkriege ausbrachen, dominierte der isolationistische Reflex. Präsident Woodrow Wilson sicherte sich 1916 seine Wiederwahl unter anderem mit dem Slogan „He Kept Us Out of War“ („Er hielt uns vom Krieg fern“).
Ein Jahr später traten die USA doch in den Ersten Weltkrieg ein, nachdem Deutschland den uneingeschränkten U-Boot-Krieg im Atlantik wieder aufgenommen hatte. Danach vollzog Wilson eine Kehrtwende, er regte die Gründung des Völkerbundes an, der ersten globalen Organisation, in deren Rahmen Konflikte friedlich gelöst werden sollten. Bis heute steht der Begriff Wilsonianismus für eine idealistische US-Außenpolitik. Doch der Kongress in Washington sabotierte seine Pläne, die USA traten der Vorgängerorganisation der UNO nie bei.
Im Kalten Krieg ins Vietnam-Debakel
Danach erlebte der Isolationismus in den USA seine letzte Hochblüte. Sie endete mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour am 7. Dezember 1941. Denn auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die US-Außenpolitik expansionistisch. Im Kalten Krieg galt es, die „rote Gefahr“ zurückzudrängen, und dafür war Washington kein Mittel zu schmutzig. Mehrfach wurden unliebsame Regime gestürzt (Iran, Guatemala, Chile, Grenada). Seither haftet den USA das Image eines Landes an, das seine Interessen ohne Skrupel verfolgt. Die Kommunismus-Paranoia führte Amerika schliesslich ins Debakel des Vietnamkriegs.
Mit dem Fall der Berliner Mauer kehrte der Isolationismus zurück, wenn auch nicht so stark wie früher. Die Zeiten hatten sich geändert, Amerika konnte sich nicht mehr einfach aus der Weltgeschichte abmelden. Doch George Bush senior wurde 1992 trotz seines Triumphs über Saddam Hussein im zweiten Golfkrieg als Präsident abgewählt, weil er sich in den Augen der Wähler zu wenig um die Innenpolitik gekümmert hatte. Später hatte Bill Clinton große Mühe, sein Land davon zu überzeugen, sich im Jugoslawien-Konflikt zu engagieren – gemäss Monroe-Doktrin eine „europäische Angelegenheit“.
Mit dem 11. September 2001 kam die nächste Zäsur: George W. Bush – selber isolationistisch veranlagt – ließ sich von den neokonservativen „Falken“ einspannen und leitete die expansivste Phase der US-Geschichte ein. Damit ist es vorbei. Umfragen zeigen, dass der Isolationismus in den USA so populär ist wie lange nicht. Kein Wunder angesichts der gigantischen innenpolitischen Probleme (Arbeitslosigkeit, Verschuldung, marode Infrastruktur), die das Land bewältigen muss.
Ein fundamentaler Denkfehler
Amerika tendiert zum Rückzug ins Schneckenhaus. Das zeigte sich während des Libyen-Einsatzes der Nato, an dem sich die Regierung Obama nur diskret beteiligte. Doch selbst dafür wurde sie von republikanischen Politikern kritisiert, die zu Zeiten von Präsident Bush noch stramm im Gleichschritt marschiert waren. Senator John McCain, ein aussenpolitischer Hardliner, gab am Sonntag auf „Fox News“ zu, dass die öffentliche Meinung in den USA einen neuen Kriegseinsatz im Mittleren Osten ablehnt: „Ich glaube nicht, dass wir die Vereinigten Staaten in diesem Teil der Welt nochmals in einem Krieg erleben werden.“
Eine totale Abschottung ist jedoch illusorisch, dafür gibt es zu viele globale Krisenherde. Amerika wird mit seinem Militär – der größten Streitmacht der Weltgeschichte – als Ordnungsmacht weiter gefordert sein. Was nicht ohne Ironie ist, denn zum Credo der Isolationisten gehört die Überzeugung, die USA müssten militärisch so stark sein, dass niemand es wagt, sich mit ihnen anzulegen. Ein fundamentaler und sehr amerikanischer Denkfehler, denn Stärke provoziert Gegenreaktionen. Erst recht, wenn man wie Al Kaida überzeugt ist, dass sich hinter der Militärmacht eine schwache und dekadente Gesellschaft verbirgt.

 De Maart
De Maart





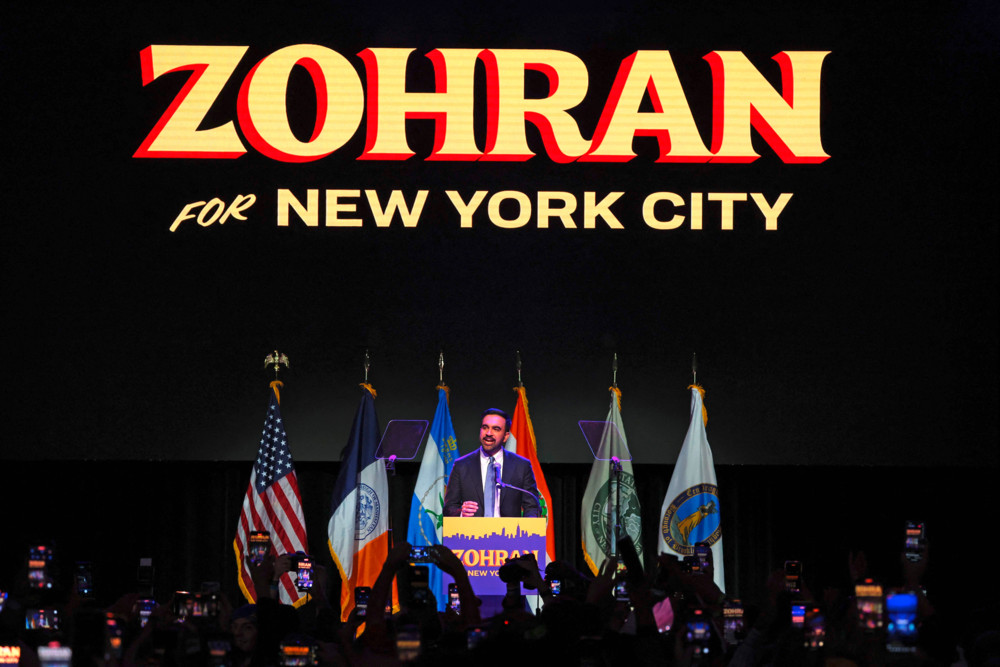


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können