Seit seiner Entlassung hält sich Ralphie (Jesse Eisenberg) mit Uber-Fahrten über Wasser. Seine hochschwangere Freundin Sal (Odessa Young) arbeitet als Verkäuferin – ohne deren Einkommen könnten sich beide weder die bescheidene Wohnung noch die teuren Einkäufe für das bald kommende Baby leisten. Abends macht Ralphie Krafttraining, um schneller zum Muskelpaket zu werden, verkauft ihm ein Bekannter – Freunde scheint er keine zu haben – diverse Steroide.
Als dieser Freund ihn zu einem unverbindlichen Treffen mit Gleichgesinnten einlädt, müssten eigentlich die Alarmglocken läuten. Für Ralphie, der nur schwer seine Wut über die Welt im Griff hält, kommt diese Gemeinschaft jedoch wie gerufen – auch wenn er, abgesehen von der Erkenntnis, dass sie ihm mit zwei Sachen, die ihm fremd sind – Verständnis und Kaufkraft – gegenübertreten, keinen Plan hat, was diese Jungs eigentlich von ihm wollen.
Schnell stellt sich heraus: Dad Dan (Adrien Brody) ist der Sektenführer einer Gruppe Männer, die den Frauen und jeder sexuellen Aktivität abgeschworen haben. Während des Rituals, bei dem jeder, ganz gleich, ob er jetzt ein „Dad“ oder ein „Son“ ist, erstmals erläutert, wie lange er schon abstinent ist – als wäre Vögeln wie Trinken (wohlgemerkt sind Dad Dans Jünger nicht sexsüchtig gewesen, im Gegenteil, Brodys Figur scheint eher Menschen zu rekrutieren, die eh kaum mehr Sex haben) –, bevor dann die erbauenden Slogans folgen, bei denen es darum geht, dass Männer in dieser femininen, verweichlichten Welt nichts mehr zu sagen haben und ihre Selbstbestimmung mühevoll zurückerobern müssen.
Wie bei Aronofskys „The Wrestler“ oder auch „The Fight Club“ wird hier eine sehr virile, testosterongeladene Welt marginaler Existenzen porträtiert – in Anlehnung an die „Manosphere“ im Netz thematisiert Trengroves Film toxische Männlichkeit und wie sie, quasi im Umkehrschluss ihrer öffentlichen Anprangerung, in Nischengemeinschaften ihren Nährboden findet.
Dad Dan ahnt jedoch nicht, was er bei Ralphie loslöst, als er diesem Mut zuspricht und sagt, Ralphie habe eine enorme Schaffens-, aber auch viel Zerstörungskraft in sich. Da Ralphie wohl der Meinung ist, mit seiner schwangeren Freundin hätte er das Kapitel Schaffenskraft abgeschlossen, löst Brodys Figur in ihm unwissentlich einen Wirbelsturm an Gewalt aus.
Gegen Ende wird der Film, wie seine Hauptfigur, etwas wirr und zerfahren – während sich die Ereignisse überschlagen, scheint Trengrove auch ein bisschen die Charakterentwicklung seines Ralphie aus dem Griff zu verlieren: So wirkt die schockierende Szene, in der Ralphies unterschwellige Homosexualität ausgelebt wird, etwas aufgesetzt.
Wo viele Beiträge ihre Zeit überstrapazieren, reichen die 96 Minuten dieses Films nicht aus, um Ralphies Geschichte ordentlich fertig zu erzählen. Es ist dramaturgisch durchaus verständlich, wieso es gegen Ende knüppeldick kommt, dies führt aber dazu, dass der Film im letzten Drittel trotz eines hervorragenden Jesse Eisenberg zu überstürzt wirkt.









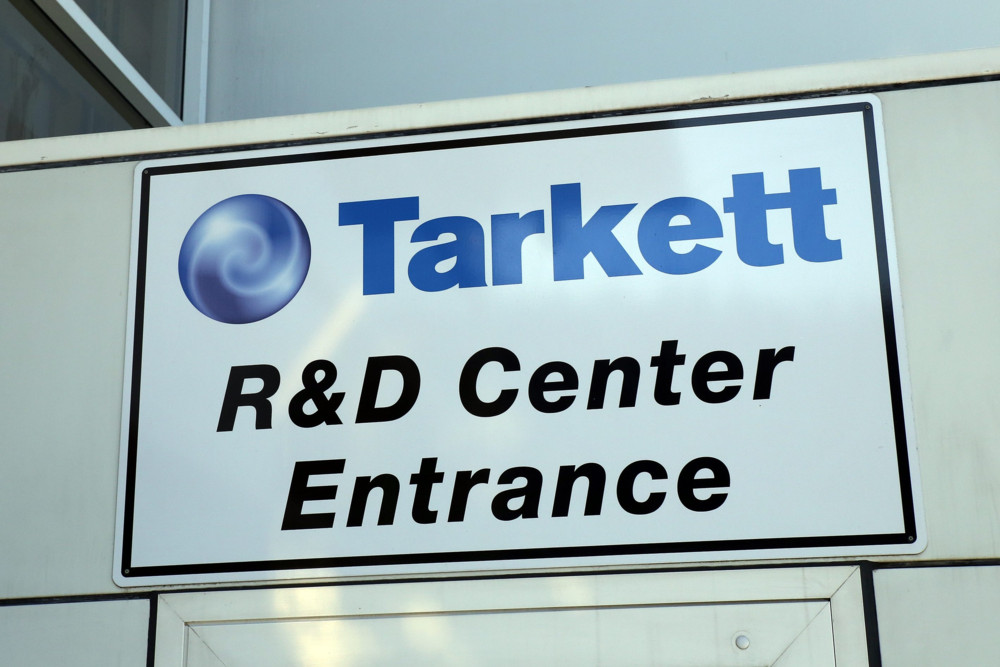
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können