„Es ist schrecklich, was die Taliban hier gemacht haben“, sagt Masir, ein junger Afghane aus der Hauptstadt Kabul, der zum ersten Mal nach Bamiyan gekommen ist. Jetzt steht er vor einer der leeren Nischen, in die vor rund 1500 Jahren die zwei berühmten Buddhas in den weichen Sandstein gehauen wurden. Von Kopf bis Fuß 53 Meter hoch war die große Figur, 35 Meter hoch die kleinere. „Es schmerzt mich als Afghane, zu sehen, was hier passiert ist“, so Masir.
Der große, männliche Buddha, hatte den Namen Salsal, den kleineren, weiblichen, nannten die Bewohner Bamiyans Shamama. Die radikal-islamischen Taliban sprengten im März 2001 diese beiden und weitere, kleinere Statuen. Vier Tage lang dauerte ihr Zerstörungswerk, bei dem ihnen der pakistanische Geheimdienst ISI mit Sprengstoffspezialisten und Bauingenieuren des Militärs unter die Arme greifen musste. Ein halbes Jahr später flogen die Terroristen der Al Kaida ihre Angriffe auf die USA, was wiederum zum jüngsten Afghanistankrieg führte, hatte die Taliban-Führung doch Osama bin Laden Gastfreundschaft gewährt.
Traurige Touristenattraktion
Wer die Buddhas heute besucht, bezahlt umgerechnet drei Franken Eintritt, bevor ein afghanischer Polizist das massive Vorhängeschloss zur Zufahrt aufschliesst. Eine Gruppe Soldaten der afghanischen Nationalarmee ANA mit Kalaschnikow-Gewehren sitzt auf einem Schiffscontainer und bewacht das Gelände. Am Fuß der Nischen wartet ein Museumswächter auf die seltenen Besucher. Ein aufgenähter Patch auf seiner Uniformen verrät, dass er vom afghanischen Kulturministerium und der UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur UNESCO bezahlt wird.
Schon kurz nach dem Sturz der Taliban durch die US-Intervention hatte sich die UNESCO der zerstörten Kulturgüter angenommen. Immerhin handelte es sich bei den Statuen um die weltweit größten Buddhas. Experten begutachteten die Trümmer, erste Arbeiten zur Sicherung der Überreste und zur Stabilisierung der Einsturz gefährdeten Nischen wurden durchgeführt. In den folgenden Jahren finanzierten die japanische Regierung und das deutsche Auswärtige Amt Arbeiten, welche zumindest den damaligen Zustand bewahren und einen allfälligen Wiederaufbau ermöglichen sollten.
Die eingesammelten Teile der Buddhas lagern jetzt auf Holzbalken in Schuppen mit Blechdächern, geschützt vor der Witterung und möglichen Räubern. Blaue Blechschilder beim Eingang zählen die Geldgeber auf und warnen vor herunterfallenden Steinen. Ausländische Spezialisten haben sich seit Monaten nicht mehr hier gezeigt.
Gänge im Berg
Am Fuß der Nische in der bis vor zehn Jahren Salsal aus dem Berg aufs Land schaute, befindet sich ein runder Gebetsraum. An der Decke sind noch die Überreste von Wandbildern zu erkennen, die die Taliban weggemeisselt haben. Die Gänge, die durch den Fels auf den Kopf des Buddhas führten, bleiben wegen Einsturzgefahr gesperrt.
Sie sind Teile eines weit verzweigten Netzes von Höhlen, in denen vor rund tausend Jahren buddhistische Mönche meditiert hatten. Später, nach der Islamisierung des Tals, dienten die mehreren hundert Höhlen als Wohnstätten für zahlreiche Familien. Mit der Sprengung wurde nicht nur die Buddhas zerstört, sondern auch Hunderte von Menschen obdachlos. Ausländische Hilfswerke haben ihnen ausserhalb der Stadt neue Häuser gebaut.
Bei der Nische des kleinen Buddha, ganz ausgefüllt durch ein Gerüst, das von den Stabilisierungsarbeiten zeugt, können die Gänge noch durchklettert werden: Steile, verwinkelte Öffnungen und Treppen führen zum höchsten Punkt, wo früher der Kopf war. Gebogene Armierungseisen sichern einige Aufgänge. Der Wächter eilt in Plastiksandalen durch die Gänge, weist den Besucher auf einige der versteckten Löcher hin, damit er sich nicht etwa ein Bein bricht. Durch Luken in der Felswand fällt etwas Licht ein, zuoberst eröffnet sich ein eindrücklicher Panoramablick auf den Talgrund mit seinen Kartoffelfeldern und der Ortschaft Bamiyan.
Keine Chance für Taliban
Die Provinz Bamiyan steht für ein anderes Afghanistan. Hier lebt die schiitische Minderheit der Hazara, die von den Taliban nach deren Machtergreifung fünf Jahre vor der Sprengung der Buddhas brutal drangsaliert wurde. Hinter vielen Dörfern im diesem zentralen Hochland, dem Hazarjat, das die Hazaras bewohnen, zeugen stumm muslimische Friedhöfe von den Massakern der Taliban. Wer mit den Menschen redet, hört kein gutes Wort über die selbsternannten Gotteskrieger.
Die Taliban konnten hier denn auch in den vergangenen Jahren nicht wieder Fuss fassen, im Gegensatz zu großen Teilen des Landes, die zunehmend der Kontrolle der internationialen Isaf-Truppen und der Kabuler Zentralregierung des Präsidenten Hamid Karzai entglitten sind. Bamiyan wird aus diesem Grund hierzulande gerne als Modell für eine prosperierende Zukunft des Landes gepriesen.
„Sogar unter der sowjetischen Besetzung kamen viele Touristen nach Bamiyan“, sagt Abdul Rauf Naveed. Der Geschäftsmann aus Kabul, selber ein Hazara, hat Ende des vergangenen Jahres das neueste von bald zehn Hotels in Bamiyan eröffnet, das Noorband Qalla. Der Gewinn des Hotels geht an das lokale Waisenhaus mit dem Namen Ashian-e-Samar in der Lokalsprache Dari. Seine Zielgruppe für das Hotel ist eine westliche Klientel, so bietet es Solarstrom, kabelloses Internet, Satelliten-TV und Ausflüge in die Region an. Gegenwärtig wohnen allerdings nur einige Hilfswerker der amerikanischen Entwicklungsorganisation USAID und der dänischen Flüchtlingshilfe dort. In Zukunft sollen auch andere Hotelgäste kommen, hofft Naweed.
„Afghanistan, das sind nicht nur Explosionen und Tote“, sagt die 17-jährige Parwan. „Jahrelang hat die Welt nur schlechte Nachrichten aus Afghanistan gehört, jetzt müssen die Menschen kommen und sehen, dass es auch schöne Seiten gibt.“ Auf dem Basar von Bamiyan sind die Menschen darum einhellig der Meinung, die Buddhas sollten wieder aufgebaut werden: Das würde Touristen aus dem Ausland anlocken und Arbeitsplätze schaffen.
Missgünstige Innenpolitik
Fachleute im In- und Ausland hingegen graut vor einer Art Buddha-Disneyland. Einige schlagen deshalb eine Lösung vor, bei der klar ersichtlich wäre, welche Teile original und welche neu sind. Andere wollen wenigstens die Nische des großen Buddhas leer lassen, um dessen Leere an die bilderstürmerische Tat der Taliban erinnern zu lassen. Viele Menschen hier glauben allerdings, dass der Wiederaufbau durch innenpolitische Kräfte in der Kabul blockiert werde. Man gönne den Hazara weder den Frieden noch eine Touristenattraktion.
Auf jeden Fall ist der Entscheid für einen Wiederaufbau ein politischer. Denn technisch sind die nötigen Vorarbeiten seit längerem abgeschlossen, wie auch der emeritierte Professor Armin Grün vom ETH-Institut für Geodäsie und Photogrammetrie in Zürich bestätigt. Er und sein Team haben auf der Basis von alten Fotografien Pläne der Buddhas erarbeitet. „Wir haben hochauflösende und genaue Computermodelle des großen und kleinen Buddhas, der leeren Nischen, der ganzen Felswand und sogar der weiteren Umgebung errechnet“, schreibt Grün auf Anfrage. „Aus unserer Sicht könnten die Daten für eine physische Rekonstruktion benutzt werden.“
Der Wächter am Fuss des kleinen Buddha Shamana klaubt derweil eine kleine Dose mit dem so genannten Naswar aus der Hosentasche, dem grünen Kautabak mit leicht berauschender Wirkung, der unter den Männern in Afghanistan weit verbreitet ist. Von der Stadt herauf erschallt der Gebetsruf zum Abendgebet. Er dürfte noch oft ertönen, bis entschieden ist, ob die Buddhas wieder aufgebaut werden.

 De Maart
De Maart







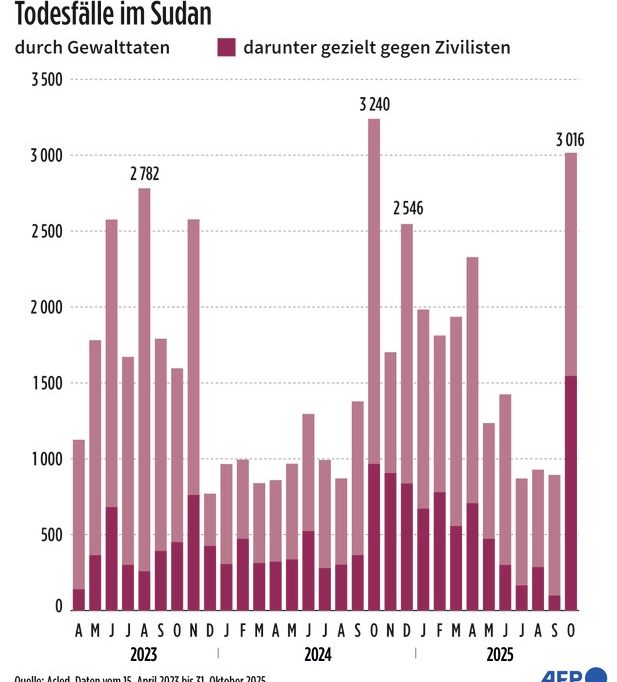
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können