Am New Yorker Times Square, wo sich sonst die Touristen drängen, herrscht Ausnahmezustand: Polizisten führen vor der schillernden Flaggschiff-Filiale von McDonald’s streikende Angestellte in Handschellen ab. „Das sind Menschen, die hart arbeiten und trotzdem nicht ohne Staatshilfe leben können“, sagt ein Beobachter. Unterbezahlt und unterbewertet – so sehen sich Amerikas Fast-Food-Arbeiter. Im ganzen Land protestieren sie.
In insgesamt 150 Städten wurden diese Woche Burger King, Wendy’s, McDonald’s und andere Fast-Food-Unternehmen bestreikt. „Fight for 15“ heißt die Initiative, sie fordert einen Stundenlohn von 15 Dollar (11,60 Euro) und eine Gewerkschaft. Von Festnahmen – etwa 500 soll es gegeben haben – lässt sich die Bewegung nicht aufhalten. „Whatever it takes“ ist ihr Schlachtruf – was immer auch nötig ist.
Frust nachvollziehbar
Der Frust ist nachvollziehbar, in keiner anderen Branche klafft die Lohnschere soweit auseinander wie im Fast-Food-Geschäft. Laut Studien verdienen die Chefs dort mehr als tausendmal so viel wie die durchschnittlichen Angestellten. Während die CEOs ihre Gehälter seit der Jahrtausendwende mehr als vervierfachen konnten und pro Jahr im Schnitt 23,8 Millionen Dollar einstreichen, bieten sie ihren einfachen Angestellten die am schlechtesten bezahlten Jobs der ganzen US-Wirtschaft. Pro Stunde gibt es in der Regel etwa neun Dollar (6,88 Euro).
Arbeitsmarktforscher der kalifornischen Berkeley-Universität haben berechnet, dass die niedrigen Löhne in der Branche die amerikanische Steuerkasse teuer zu stehen kommen. Demnach braucht mehr als die Hälfte der Familien der Mitarbeiter Sozialhilfe. Im Rest des Landes seien es nur 25 Prozent. Insgesamt verursache dies dem Staat jährlich Kosten von 7 Milliarden Dollar. Mehr als eine Milliarde Dollar an Unterstützung erhalten ausgerechnet die Fast-Food-Mitarbeiter in Form von Essensmarken.
Einkommen ungleich
Die Situation in der Branche steht stellvertretend für den Trend in ganz Amerika. In keinem Land der Welt sind die Einkommen ungleicher verteilt. Und sie driften immer weiter auseinander. Der US-Notenbank Fed zufolge haben nur die reichsten Amerikaner von der wirtschaftlichen Erholung nach der großen Rezession profitiert. Während die wohlhabendsten zehn Prozent der Bevölkerung von 2010 bis 2013 ihre Einkommen um zehn Prozent steigerten, mussten die untersten 60 Prozent Abstriche machen.
Bei Ökonomen lassen die immer massiveren Vermögensunterschiede die Alarmglocken schrillen. Der auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum, dem Treffen der globalen Managerelite im Schweizer Davos, vorgestellte „Global Risk Report“ sieht darin sogar die größte Gefahr für die Weltwirtschaft. Die Einkommensungleichheit lässt den sozialen Kitt bröckeln und kann zum gesellschaftlichen Sprengstoff werden, so das Fazit der 700 an der Studie beteiligten Experten.
Nachdem der französische Ökonom Thomas Piketty mit einem Bestseller über soziale Ungleichheit die öffentliche Debatte in den USA aufgemischt hat, sorgen die Proteste in der Fast-Food-Branche nun für neue Aufmerksamkeit. Präsident Barack Obama gefällt das. Er fordert vom Kongress ohnehin eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns und kann sich so als Anwalt der Arbeiter hervortun: „Die simple Wahrheit kann nicht abgestritten werden: Amerika verdient eine (Lohn-)Anhebung.“

 De Maart
De Maart





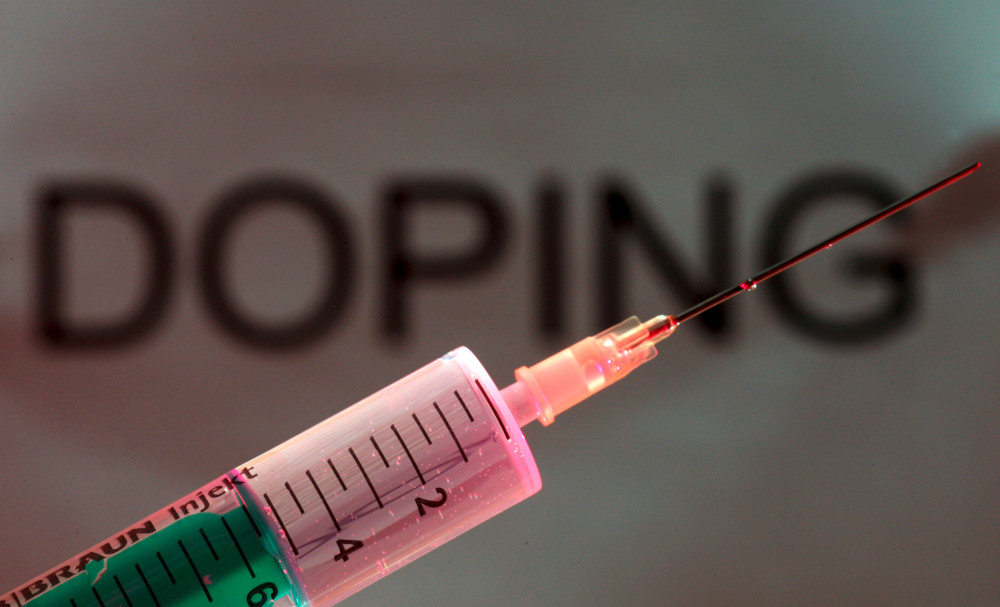


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können