„Sie wissen ja wahrscheinlich, dass er mit größerem Besuch unterwegs ist“, erklärte Guy Arendt, Staatssekretär für Kultur, am vergangenen Donnerstag bei der Vernissage mit dem nicht ganz unumstrittenen Titel „Art brut“. Gemeint war der Kulturminister Xavier Bettel, dessen Fehlen weniger erstaunte als die Tatsache, dass öffentlich erörtert wurde, wer oder was gerade wichtiger ist als Kultur. (In diesem Fall war es der Besuch des französischen Präsidenten.)
Nebst dem Versprechen, dass sich der Spitzenkandidat der DP bald Zeit nehme, um die vorhandene Kunst aus nächster Nähe zu betrachten, erfolgte ein Verweis darauf, dass im Büro des Premiers ein Bild hänge, das ein Mann mit seinem Mund gemalt habe. Warum? Na um zu bestärken, „dass diese Art brut, die heute hier ausgestellt wird, uns beiden sehr stark am Herzen liegt“, so Arendt weiter. Eine fast schon befremdliche Überbetonung des eigenen (angeblichen) Interesses, das eigentlich eine Grundvoraussetzung für politische Amtsträger, die Verantwortung im Kulturministerium tragen, sein sollte. Und zwar unabhängig davon, mittels welcher Gliedmaßen Kunstwerke entstanden sind.
Diese, wenn auch sicherlich ohne wirklich schlechte Absicht ausformulierte Haltung, nistet sich ein in einen Kontext, in dem Worte eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Denn der Sprache obliegt eine große Macht und diese schafft bekanntermaßen Realitäten. Dementsprechend verdient die Titelwahl für die Ausstellung auch ein strenges Hinterfragen, zumal sie nicht auf Ansinnen der Ausstellenden selbst, sondern durch eine interne Entscheidung des Kulturministeriums begründet ist.
Der historische Kontext zählt
Der Begriff der „rohen Kunst“ geht auf den französischen Künstler und Kunstsammler Jean Dubuffet zurück, welcher 1948 die „Compagnie de l’Art brut“ gründete und zum gleichen Zeitpunkt eine Art Manifest verfasste, in dem er forderte, dass das bisherige Fundament der Kunstwelt verlassen werde solle, um sich jenseits von Galerien und Museen jener Kunst zu widmen, die zuvor isoliert existierte oder gar vernichtet wurde. Mit dem Ziel, sie zu erforschen und im weiteren Verlauf schützen zu können.*
Dubuffet machte damals einen Aufruf, man möge ihm doch bitte Werke oder zumindest Fotos von ebendiesen zukommen lassen. Diese sollten aus der Feder von Menschen stammen, die sich in einer besonderen Lebenssituation befinden, die durch Krankheit, eine Behinderung oder auch eine schlechte soziale Lage gezeichnet ist. Hinzu kommt, dass der damalige Begriff keine bestimmte Technik oder einen einzigen Stil implizierte, sondern sich auf nicht-akademische Kunst sowie nicht dafür ausgebildete Künstler bezog, deren Schaffen sich spontan vollzog.
Nun handelt es sich bei Dubuffets Plan ebenso wenig um ein vordergründig zu verurteilendes Projekt wie bei der Initiative, auf welche die „Art brut“-Ausstellung zurückgeht. Jedoch war der Ansatz, den der Kunstsammler verfolgte, eine Reaktion auf die gesellschaftliche Haltung in der Zeit, in der er lebte. Auch wenn die momentane politische Aktualität in Europa zeitweise nicht mehr wirklich darauf hindeutet, sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aber schon einige Jährchen ins Land gezogen.
Mehr als 70 Jahre nach seinem Manifest kann man sich dann doch schon fragen, ob es nicht Zeit für neue Begriffe, andere Haltungen oder wenigstens doch eine Diskussion darüber wird. Ist das von Dubuffet geäußerte Schutzbedürfnis noch immer vonnöten oder fehlt es vielleicht einfach an Verständnis dafür, dass auch Künstler, welche eine sogenannte „Behinderung“ haben, autonom agieren können und eigentlich viel eher von Menschen „behindert“ werden, die dies nicht wahrhaben wollen?
Abgenutztes Stempelkissen
Auf die Wortwahl für die Ausstellung aus der „Intro“-Reihe angesprochen, meinte Arendt vergangene Woche: „Art brut bezieht sich ja nicht nur auf Kunst von behinderten Menschen. Es ist mehr als das. Deswegen fanden wir, dass der Begriff trotzdem passend sei. Wir möchten damit aber niemandem einen Stempel aufdrücken.“ Dies erstaunt umso mehr, wenn man bedenkt, dass eines der beiden Kollektive an einer Ausschreibung des Ministeriums teilnahm, die nicht in einem direkten Zusammenhang mit Behinderungen stand, aber dann das Angebot bekam, in einem Kontext auszustellen, dessen Rahmen keinerlei Zweifel daran ließ, dass die Künstler auch eine Behinderung haben.
In den Gesprächen vor Ort ergab sich relativ zügig, dass die Wahrnehmung des Begriffs im Zusammenhang mit den Ausstellenden weit auseinanderliegen kann. Denn beispielsweise sind die Künstler des „collectif dadofonic“ schlicht und ergreifend keine Autodidakten, sondern professionelle Künstler. Die Mitglieder des „atelier d’inclusion professionnelle“ (das nicht ohne Grund nicht mehr die Bezeichnung „atelier protégé“ trägt) verdienen ihr Geld mit ihren künstlerischen Kreationen und unterziehen sich regelmäßigen Trainings, Übungen und Fortbildungsprozessen.
Obwohl Inklusion einen derart wichtigen innergesellschaftlichen Schritt darstellt, ist der Begriff nicht davor gefeit, gerade aktuell in diversesten Parteiprogrammen wie ein plumpe Floskel anzumuten. Nichtsdestotrotz freuen sich Akteure aus dem sozialen Bereich häufig, wenn zumindest das Thema und die Menschen, die es ausmachen, mehr Sichtbarkeit erlangen. Auch wenn dann Etikettierungen so ziemlich allem widersprechen, auf das sie eigentlich hinarbeiten. Der Preis, den sie dafür zahlen, ist nicht selten ein hoher, der zeigt, dass das Ziel, für das sie sich engagieren, leider noch längst nicht erreicht ist. Daher muss man Herrn Arendt wenigstens einmal recht geben, denn vor der „Galerie beim Engel“ gestand er in Bezug auf das politische Engagement in diese Richtung: „Da ist definitiv noch Luft nach oben.“
* Vgl. Malgorzata Bogaczyk-Vormayr: Art brut oder die Überwindung der Biomacht, in Ethics in Progress, Vol. 5 (2014). No. 2. 77 – 102.


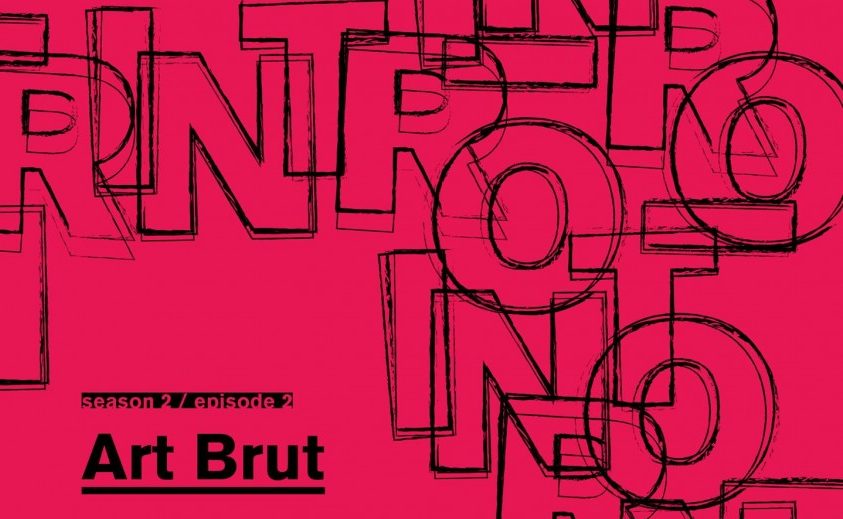






Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können