„Es gibt zwei Welten“, heißt es in „Die Nulllinie“, dem neuen Buch von Szczepan Twardoch. Kurz darauf wird erklärt, was die eine Welt ist und was die andere. Die eine ist Kyjiw, aber auch Warschau, die andere ist die Front des Krieges. „Jetzt sitzt du mit Ratte in diesem Loch und erzählst ihm, so wie man eben im Krieg erzählt.“ In dem „Roman aus dem Krieg“, wie es im Untertitel heißt, führt der Autor seine Leser in den Stellungskrieg im Südosten der Ukraine, wo der Dnipro die Linie zwischen russischen und ukrainischen Truppen bildet. Meistens sitzen die Kämpfer in ihren Unterständen und warten, spähen und lauschen. Sie harren an der Nulllinie aus, an vorderster Front..
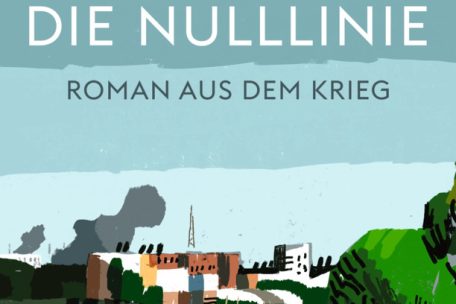
Einer ist ein Studienabbrecher, einer war Barmann in Berlin. Ein anderer, ein Scharfschütze, war Gastwirt in Galizien. Einer trägt den Kriegsnamen „Ratte“. Schließlich gibt es noch die erzählende Hauptfigur Kon, ein Drohnenpilot aus Polen, der Geschichte studiert hat. Er ist das Alter Ego des Autors und führt einen inneren Dialog in Du-Form. So sagt er etwa über sich, er sei einer, „der den Tod sucht und jetzt plötzlich festgestellt hat, dass er doch leben will“. Er ist Zuja zugeneigt, die schon 2014 als Sanitäterin im Einsatz war. Sie sagt, sie habe erfahren, „wie im Krieg die Liebe schmeckt, wie rasch sie detoniert, einer Tretmine gleich, und in ihren Armen erlischt, glitschig von Blut“.
Kons Vater war Ukrainer und heiratete in Schlesien eine Deutsche. Aus Schlesien stammt auch Szczepan Twardoch. Der 1979 in Pilchowice geborene Schriftsteller studierte einst Soziologie und Philosophie. Mit dem 2012 erschienenen Roman „Morphin“ gelang ihm der Durchbruch. In dem von Olaf Kühl auf Deutsch übertragenen Buch führt Ende der 1930er-Jahre in Warschau, kurz nach dem deutschen Überfall auf Polen, ein Reserveoffizier ein ausschweifendes Leben und wird eher zufällig zum Widerstandskämpfer. Der Roman spielt zwar im Krieg, ist aber eher ein „Anti-Front-Roman“ – und er stellt die von Twardoch oft behandelte Frage, ob es überhaupt einen Sinn in der Geschichte gibt.
Der Schriftsteller konzentriert sich vor allem auf die polnische Geschichte, etwa in dem Schlesien-Roman „Drach“ (2014) oder in „Der Boxer“ (2017) über den Aufstieg des jüdischen Unterweltkönigs Jakub Shapiro und in dem im Jahr darauf veröffentlichten „Das schwarze Königreich“. „Demut“ (2020) beschreibt den Identitätskonflikt eines Bergarbeitersohnes in der Zwischenkriegszeit. In „Kälte“ (2022) entdeckt ein Schriftsteller namens Twardoch das Tagebuch eines russischen Revolutionärs, der unter Stalin im Gulag landete und dann bei einem außerhalb der Zivilisation lebenden Volk Zuflucht fand.

Twardochs Romane sind düster und blicken in die Abgründe des menschlichen Seins. In „Die Nulllinie“ beschreibt Twardoch gebrochene Figuren. Sie hassen die Armee, aber sie sehen es als eine Notwendigkeit, zu kämpfen. Der Autor war selbst mehrmals an der Front. Er sammelte Spenden, schmuggelte Drohnen und Wärmebildkameras zur ukrainischen Armee und verbrachte einige Zeit im Schützengraben. Allerdings habe er erst danach geschrieben, als er wieder zurück war, erklärte Twardoch in einem Interview. „Das verschaffte mir Distanz“, sagte der Autor. Ursprünglich habe er einen Essay über den Krieg beabsichtigt, aber wechselte ins Fiktionale, weil er „diesen Krieg so nahe an der Wahrheit beschreiben“ wollte, wie es ihm irgendwie möglich erschien. Die zwischen der Erzählung und den Protagonisten aufgebaute Distanz entspreche der Vogelperspektive auf den Krieg aus der Sicht einer Drohne, so Twardoch. „Die Nulllinie“ ist in der Darstellung des Kriegsalltags ernüchternd und zugleich meisterhaft – und von Olaf Kühl einmal mehr kongenial übersetzt.
In einer von Serhij Zhadans Kurzgeschichten, die unter dem Titel „Keiner wird um etwas bitten“ auf Deutsch erschienen sind, warten zwei Männer auf einen neuen Arbeitskollegen. Am Ende stellt sich heraus, dass der Mann seit einem Fronteinsatz blind ist. Zhadan erzählt leise und eindringlich, oft verhalten, manchmal auch drastisch, meistens unmittelbar und nah an seinen Figuren, dagegen bleiben die Umstände der Begebenheiten und Begegnungen zumindest einige Zeit im Dunkeln. Die zwölf Geschichten handeln weniger vom Krieg selbst als von seinen gesellschaftlichen Auswirkungen und Folgen für die einzelnen Menschen, die er beschreibt. Viele Beziehungen sind zerrissen, die Einsamkeit regiert.

Die erste Geschichte handelt von Artem und seinem Kameraden, die eine Frau aus einem zerbombten Haus holen wollen. Sie finden die Frau in ihrem Bett, friedlich. Auf einem Foto ist sie als junges Mädchen, das in die Zukunft blickt. In der letzten Geschichte kommen dieselben Männer vor, die Hilfsgüter zu Kindern bringen, die in einer heruntergekommenen Baracke hausen – ohne ihre Eltern. Auch hier heißt es: „Sie schauen in die Zukunft.“ Allerdings sehen sie etwas, was man nicht genau erkennen kann, „etwas Langandauerndes, Kompliziertes, voll Schmerz, voll Freude. Etwas, an dem man andere nicht teilhaben lässt.“
Zhadan hat mit „Nachrichten vom Überleben im Krieg“ (2022) bereits ein Kriegstagebuch verfasst. In dem Gedichtband „Chronik des eigenen Atems“ versammelt er Texte, die vor und nach Kriegsbeginn entstanden sind. Jetzt liegt mit „Keiner wird um etwas bitten“ ein neuer Band vor, illustriert mit Schwarzweiß-Zeichnungen des Autors: Skizzen von Bäumen und Strommasten, zerstörten und nicht zerstörten Häusern. „Die menschenleere Stadt glich einem leeren Musikinstrumentenkoffer – sperrangelweit geöffnet, deplatziert“, heißt es einmal. „‚Schön, so ohne Menschen‘, sagt Softie. ‚Ohne Menschen gibt’s nicht‘, widersprach Artem.“ Auch wenn der Krieg vieles auslöschte, die Poesie hat noch Platz bei Zhadan. Der Krieg hat das Leben der Menschen radikal verändert. Denn überall steht der „große Tod“ mit herum, wohin man auch geht. Der Krieg wirft einen langen Schatten.

Zhadan, 1974 im ostukrainischen Luhansk geboren, zählt zu den bekanntesten Schriftstellern seines Landes. Sein Roman „Die Erfindung des Jazz im Donbass“ (2012) wurde von der BBC zum Buch des Jahrzehnts gekürt. Zhadan veröffentlichte Lyrikbände und organisierte in Charkiw Literatur- und Musikfestivals, bei denen er auch mit seiner eigenen Band auftrat. Auf Deutsch heißt diese „Hunde im Kosmos“. Die Geschichte des Romans „Depeche Mode“ handelt von der postsowjetischen Umbruchzeit in den 1990er Jahren. Mit den Songs von Depeche Mode entfliehen drei junge Männer dem Alltag. Derweil erzählt „Internat“ vom Krieg in der Ostukraine seit 2014. Das Buch wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2018 ausgezeichnet. Vier Jahre später erhielt den Zhadan den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Seit einem Jahr ist er Soldat. Er hat sich freiwillig gemeldet, schreibt aber weiter Gedichte und Geschichten.
„Zeit gab es so viel wie Luft zum Atmen“, so Zhadan. „Solange es etwas zum Atmen gab, solange gab es Zeit. Alles andere schien viel weniger zwingend und notwendig.“ Eine Schule steht nach einem Granatenangriff leer, Schüler und Lehrer bleiben zu Hause. Es ist trostlos. Ein Lehrer bewacht das verlassene Gebäude. Manche Geschichten haben unerwartete Wendungen. Etwa die der 25-jährigen Nadia, die einen ehemaligen Klassenkameraden nach langer Zeit wiedertrifft. Es wirkt wie ein hilfloser Versuch, wieder ins Gespräch zu kommen. Allmählich wird klar, dass Nadia den Schulfreund in einem Krankenhaus besucht, wo er als versehrter Soldat lebt. Es sind oft nur kurze Momente und Szenen, umso mehr bleiben sie im Gedächtnis haften. Beim Begräbnis für einen Soldaten spricht der Priester von Gnade und Erinnerung. Neben dem Sarg steht die Ehefrau des Verstorbenen, nicht weit davon seine Geliebte. „Ihre Erinnerung wird für den Rest ihres Lebens verborgen bleiben“, heißt es.
– Serhij Zhadan: Keiner wird um etwas bitten. Neue Geschichten. Aus dem Ukrainischen von Juri Durkot und Sabine Stöhr. Suhrkamp-Verlag, Berlin, 144 Seiten, 24 Euro
– Szczepan Twardoch: Die Nulllinie. Roman aus dem Krieg. Aus dem Polnischen von Olaf Kühl. Rowohlt-Verlag, Berlin, 2025. 256 Seiten. 24 Euro.

 De Maart
De Maart









Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können