Das Bellevue ist der Ort schlechthin, um sich in Zürich mit jemandem zu treffen. Der Platz, zwischen Altstadt, Limmat und Zürichsee gelegen, befindet sich an einem Verkehrsknotenpunkt mit der Tramstation, dem Kiosk und dem Kino „Le Paris“. Hier fängt die Geschichte von Anneli und Thor an, zweier verlorener Seelen, einer Schweizerin und eines Nigerianers. Sie wird in „Daily Soap“, Nora Osagiobares erstem Roman, als für Verschwörungstheorien anfällige Impf- und Abtreibungsgegnerin eingeführt, er als süchtig nach Red Bull. Beide sind die Eltern von Toni, die Erzählerin in dem Roman, obwohl ihr leiblicher Vater der ebenfalls aus Nigeria stammende Maler Louis Efe di Cabrio ist, mit dem Anneli eine Affäre hatte.
Dass sich Anneli (Mädchenname: Killer) und Thor Osayoghoghowemwen aufgrund ihrer verschiedenen Lebensgewohnheiten scheiden lassen, sei mal vorweggenommen. Beide bilden zwar das Epizentrum des Buches. Doch die eigentliche Protagonistin ist Toni, die in die Kategorie „Cappuccino mit einem Schuss mehr Milch, also Cappuccino Macchiato und einem Löffel Rohrzucker, serviert an einem lauen Sommerabend in Sri Lanka“ fällt. So stuft sie zumindest das „Bundesamt für die Rationalisierung Andersfarbiger anhand von Cappuccino beziehungsweise Kaffee“ ein – kurz BARACK genannt. Ganz anders ist die „kreideweiße“ Zwillingsschwester Wanda. Als Ursache dafür wird eine sogenannte heteropaternale Superfötation angegeben, „auch unter dem klingenderen Begriff Überschwängerung bekannt“. Anneli war ungefähr zur gleichen Zeit auch mit Zita Bodecas Mann Armin Banal ins Bett gesprungen.
„Sturm der Triebe“
Während Wanda sich als begabte Schachspielerin herausstellt, hat Toni „ein ganz anderes Talent: das Twerken“ – ein kreisender, ruckartiger Tanzstil mit dem Fokus auf dem Gefäß. „Dazu kommt, dass ich Vertreterin eines fetischisierten Hauttons bin“, sagt Toni. Für sie ist ihre Lieblingssoap „Sturm der Triebe“, nach der sie regelrecht süchtig ist, ein Rückzugsort, zu dem sie vor dem Alltag flieht. „Seifenopern sind eine extrem politische Angelegenheit“, weiß Osagiobare, wie sie in einem Interview sagte. Doch „Sturm der Triebe“ ist nicht der einzige Grund für ihre Kopfschmerzen, sondern ihre Familie und deren Umfeld. Da stellt sich ganz beiläufig die Frage, was eigentlich mehr Seifenoper ist: die fiktive Soap oder das reale Leben?
Der Roman folgt in der Tat den Kriterien einer Soap, bestehend aus den einzelnen Beziehungsgeschichten und anderen Affären. Darin geht es etwa um einen Skandal, in den das Modeunternehmen „Banal & Bodeca“ aufgrund einer rassistischen Kampagne verwickelt ist. Dabei ist Zita Bodeca alles andere als eine „typische“ Rassistin. Das Traditionshaus möchte wieder mithilfe einer TV-Sendung sein Image aufpolieren und sich daher besonders weltoffen zeigen. In der von der Firma produzierten Serie soll sich der Sohn der Familie und Erbe des Unternehmens, Paul Banal, mit seinem schwarzen Partner in einer homosexuellen Beziehung zeigen. Mit der Soap will sich die Firma also „pinkwaschen“. Allerdings weiß die Familie nicht, dass Paul wirklich mit einem Afrikaner zusammen ist, mit Prince Okiti, ausgerechnet Thors Bruder, wie er ein ehemaliger Pornodarsteller und heute ein ausgemachter „Bünzli“, ein Spießer.
Diese kurze Inhaltsbeschreibung könnte wegweisend sein: Die einen Leser würden vielleicht an eine belanglose, leichte Sommerlektüre für den Urlaub denken, die anderen gleich ob der Fülle der Klischees die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die Autorin greift in der Tat auf Elemente einer Soap und den Rhythmus von Reality-TV-Formaten zurück, aber ihr Buch ist viel mehr. Es handelt sich um eine bissige Satire mit dem Hintergrund einer fast schon dystopisch wirkenden Schweiz, in der die Bürger nach Hautfarben eingeteilt sind. Dafür zuständig ist das besagte Bundesamt mit dem einprägsamen Kürzel BARACK. Das Kernthema des Romans ist der Rassismus – und mit ihm auch die Frage, ob nicht jeder ein Rassist ist oder wie viel „Bünzli“ – also Spießbürger – in jedem steckt, zu dessen Grundausstattung die Fremdenfeindlichkeit gehört. Als typischer „Bünzli“ kann etwa der Einbürgerungsbeamte Max Bodmer in Rolf Lyssys Film „Der Schweizermacher“ (1978) mit dem Kabarettisten Emil Steinberger genannt werden. Das rassistische BARACK kann als radikalisierte dystopische Form von dessen Behörde interpretiert werden.
Gezeigt und auf die Spitze getrieben wird die schweizerische Ordnungssucht. Das klingt absurd und ist doch so nah an der Realität. Der Roman verfügt über zahlreiche Fußnoten, als verfolge die Autorin einen wissenschaftlichen Anspruch, dabei führt sie diesen eher ad absurdum. Die Handlung ihres Romans legt ein hohes Tempo vor, sodass die etwa 280 Seiten flott zu lesen sind, ohne dass man das Buch gern aus der Hand legen mag. Beim Thema Alltagsrassismus denkt, wer sich bereits damit eingehender beschäftigt hat, an die oft nur beiläufig fallenden Äußerungen, die manchmal überhört und oft verharmlost werden – aber die Adressaten wie kleine „Mückenstiche“ treffen, wie es die deutsche Autorin und Journalistin Alice Hasters einmal nannte: „Kaum sichtbar, im Einzelnen auszuhalten, doch in schierer Summe wird der Schmerz unerträglich. Diese Mückenstiche haben einen Namen: Mikroaggressionen.“ Der Migrationsforscher Mark Terkessidis spricht von der „Banalität des Rassismus“, der bereits bei der ständigen Frage beginnen kann: „Woher kommst du?“ Auch Ignoranz sei eine Mikroaggression, so Alice Hasters. „Nur, weil man sich nie bewusst Gedanken über Herkunft, Hautfarbe und Identität gemacht hat, läuft man nicht vorurteilsfrei durch die Gegend. Man bemerkt nur nicht, dass man diese Vorurteile hat.“
„Frustrationsverdauung“
Nora Osagiobare hat selbst viel Erfahrung damit gemacht. Aufgewachsen als Tochter einer Schweizerin und eines Nigerianers in einem kleinen Dorf im Kanton Zürich, besuchte sie in der nahen Großstadt das Gymnasium. Später studierte sie Literarisches Schreiben in Biel und in Wien. Sie finde es nur noch lächerlich, so Nora Osagiobare im Interview, „wenn man ernst über etwas schreibt, das man schon seit Jahrhunderten zu dekonstruieren versucht“. Weiter sagt sie: „Ich kann nicht ernst über Rassismus schreiben, weil es einfach auch extrem lächerlich ist und weil alles schon gesagt worden ist.“ Es gebe nichts, was dem auf ernsthafter Ebene hinzuzufügen sei. Ihre Kritik an der Gesellschaft äußert Osagiobare daher auf humorvolle Weise. Die Autorin bezeichnet den Roman als „Frustrationsverdauung“. Sie stellt ihm eine Triggerwarnung voran – „In diesem Text wird mehrmals eine Banane gegessen“ – sowie ein Zitat von Arthur Schopenhauer: „Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will.“ Die Personen des Buchs werden nicht nach der Reihenfolge ihres Erscheinens oder gar alphabetisch aufgelistet, sondern „nach steuerbarem Vermögen sortiert“, angeführt von Firmeninhaberin Zita Bodeca. Den letzten Platz nimmt Tonis Mutter Anneli ein.
Triggerwarnung: In diesem Text wird mehrmals eine Banane gegessen.
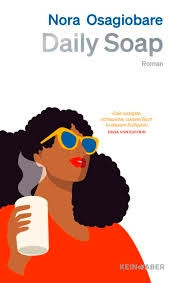
Die bisweilen stark überzeichnete, satirische Gesellschaftskritik von Nora Osagiobare ersetzt so manche theorielastige Herangehensweise, über deren Ernsthaftigkeit sie sich mit den Fußnoten lustig macht. „Daily Soap“ ist doppelbödig und selbstironisch, das Beziehungsgeflecht der Figuren steht im Vordergrund. Am Ende fragt sich der Leser, was eigentlich lustig oder traurig ist. Schließlich hat der Roman düstere Passagen bis hin zur tödlichen Gewalttat einer schwarzen Person angeblich „aus Versehen“ und zu der Anspielung auf die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis, was die weltweiten Black-Lives-Matter-Proteste entfachte. Inspiriert wurde die heute 33-jährige Autorin nach eigenen Worten nicht zuletzt von Fran Ross, einer jüdisch-afroamerikanischen Schriftstellerin. Für ihren Roman hat Nora Osagiobare, übrigens kürzlich in Klagenfurt für „Daughter Issues“ mit dem Kelag-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb ausgezeichnet, bereits viel Lob erhalten, unter anderem von der Neuen Züricher Zeitung, „weil so viel Wahrheit in den fett über die Ränder hinausgemalten Karikaturen steckt“.
Nora Osagiobare: Daily Soap. Roman. Kein & Aber, Zürich 2025, 288 Seiten. 24 Euro.

 De Maart
De Maart









Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können