Von „zehn großen Schritten nach vorn“ hat Roberta Metsola, die maltesische Präsidentin des Europaparlaments, gesprochen und dabei den kürzlich beschlossenen Migrations- und Asylpakt der Europäischen Union gemeint. Dabei erweckte die Diskussion über die Reform der Asylpolitik in Europa den Eindruck, sich nicht wirklich nach vorn, sondern im Kreis zu bewegen. Vor allem aber basierte sie auf einer Reihe von Klischees und falschen Annahmen. Zudem scheint ein Großteil der demokratischen Parteien Europas in Anbetracht des befürchteten Rechtsrucks bei den Europawahlen wie das Kaninchen vor der Schlange zu verharren, in diesem Fall vor den Rechtspopulisten und Rechtsextremen.
Der Diskurs habe mit der Art und Weise, wie Migration wirklich funktioniert, oft kaum noch etwas zu tun gehabt, bemängelt der niederländische Migrationsforscher Hein de Haas in einem Spiegel-Interview. De Haas hat mit einigen Mythen, die sich um das Thema Migration ranken, in seinem jüngst erschienenen Buch „How Migration Really Works“ aufgeräumt. So werde die Migration fälschlicherweise als Problem betrachtet, schreibt er. Dabei sei sie weder ein Problem noch die Lösung eines Problems, sondern ein ganz normaler Prozess: „Wir waren immer schon unterwegs.“ Oft heiße es, dass das Migrationsaufkommen so hoch wie nie zuvor sei. Falsch: Wir leben nicht in einer Zeit, in der die Migration neue Rekorde erreicht, stellt De Haas fest. Sie sei eher stabil, zwischen 1850 und 1950 hätten sich wahrscheinlich mehr Menschen unterwegs befunden. Nur wanderten damals vor allem Europäer nach Übersee aus, heute ist Europa das Ziel.
Ein anderer Mythos, den sich De Haas vorknöpft, besagt: „Die Klimakrise wird zu einer Massenmigration führen.“ Dies hält der Soziologe eher für unwahrscheinlich. Auch die Theorie, man müsse nur die Fluchtursachen, also die Misere in den betroffenen Ländern, etwa mit Entwicklungshilfe bekämpfen, schon würde es weniger Migration geben, sei ein Trugschluss. „Tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall“, schreibt de Haas. Er weist auf eine mittlerweile wissenschaftlich erwiesene Erkenntnis hin: „Wirtschaftliche Entwicklung führt nicht zu weniger, sondern zu mehr Auswanderung.“ Zumindest in einem gewissen Maß. Außerdem sind es nicht etwa die Ärmsten, die auswandern, sondern jene, die sich die teure Reise leisten können. Sowieso bleiben die meisten Migranten im eigenen Land oder auf ihrem Kontinent und wandern dort in die Ballungsräume.
Überhaupt wäre es besser, den althergebrachten eurozentristischen Blick abzulegen und zumindest zu versuchen, die Perspektive der Migranten zu verstehen. Sie haben viel Geld in ihre Flucht bzw. Auswanderung und in ihre Zukunft investiert und dabei ungeheure Risiken in Kauf genommen, um sich und ihren Familien ein besseres Leben zu ermöglichen. In den Zielländern besteht eine je nach Wirtschaftslage mehr oder weniger große Nachfrage nach Arbeitskräften. Die gilt nicht nur für Fachleute: Selbst gering qualifizierte Arbeitskräfte sind zurzeit in der Europäischen Union gefragter denn je. Doch viel zu häufig werden in der Debatte Asylpolitik und andere Formen der Migration miteinander vermischt.
Dass das Recht auf Asyl jedem zustehen soll, der vor Krieg oder Verfolgung flieht, darüber waren sich auch die Diskussionsteilnehmer einer von der „Plateforme immigration et intégration Luxembourg“ (PiiLux) organisierten „Table ronde“, allesamt Kandidaten bei den kommenden Europawahlen, am Mittwochabend weitgehend einig. Dies gilt ebenso für die mit dem Migrationspakt eingeforderte Solidarität unter den EU-Mitgliedstaaten.
Doch in der politischen Praxis wird weiter auf der Klaviatur der Angst gespielt und werden Schreckgespenster wie jenes der Überfremdung an die Wand gemalt. Nach dem Motto „Grenzen dicht für die Festung Europa“ lässt sich die sogenannte irreguläre Migration nicht bekämpfen. Sie fördert diese sogar und damit auch die Schleuserkriminalität, indem sie eine Torschlusspanik auslöst. Eine Verschärfung der Asylpolitik nach dem Prinzip von Abschottung und Abschreckung wird nicht funktionieren, weil sich immer wieder neue Fluchtwege ergeben werden. Es ist nur eine Scheinlösung. Aber auch die Devise „Komme, wer kommen mag“ führt in die Irre und blendet die Realität aus. Migranten sind nicht per se „gut“, sondern weder „gut“ noch „schlecht“. Immigration und Integration bedeuten ein schweres Stück Arbeit. Wer schon mal emigriert ist, hat festgestellt, dass es kein Spaß ist, sondern eine Lebensentscheidung.




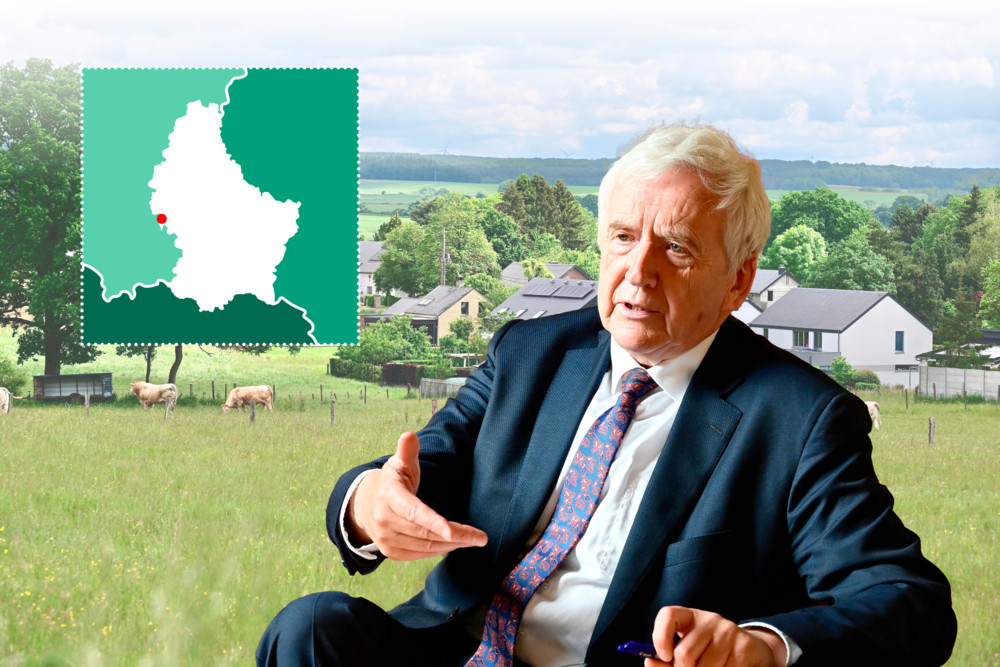





Wenn die Schleuser 5000 -15000 Dollar an einem * Fluechtling " verdienen ,ist es doch logisch dass es nicht die Aermsten sind die sich auf den Weg machen .