„When bankers get together for dinner, they discuss art. When artists get together for dinner, they discuss money.“ Dieser Aphorismus von Oscar Wilde resümiert den Briefwechsel zwischen dem Misanthropen Thomas Bernhard und seinem Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld, den Marion Rothhaar in einer Koproduktion mit dem Schauspielhaus Salzburg auf die Bühne des Kapuzinertheaters bringt, recht gut. In Auszügen aus 500 Briefen, die in knapp 20 Jahren zwischen den beiden Männern gewechselt wurden, erlebt der Zuschauer, was anfangs den verschiedenen Etappen einer Freundschaft entspricht – die zaghaften Annäherungsversuche, die gemeinsamen Leidenschaften, der gegenseitige Respekt, die Spannungen und Streitsituationen.
Schnell erkennt man allerdings die wahre Beziehung zwischen einem selbstbezogenen Autor, der sein Gegenüber im stillen Kämmerlein verbal erpresst, demütigt, hofiert, und einem geduldigen Verleger, der gute Literatur veröffentlichen will – und dem manchmal der Kragen zu platzen droht: „Auch ein Verleger ist ein Mensch. Auch er braucht seine Streicheleinheiten. Wenn er nur (…) wie ein Hund geprügelt wird, dann kann er ja nur noch hündisch werden …“, schreibt Unseld am 15. Juli 1975.
(Un)diplomatischer Austausch
Die Monotonie der Erzählsituation – Bernhard verschiebt den Abgabetermin seiner Texte, verlangt einen Vorschuss; Bernhard regt sich über die Dummheit der Kritiker auf, erkundigt sich nach seiner nächsten Rate; Bernhard gibt dem Verlag die Schuld an den schlechten Verkaufszahlen von „Verstörung“, verlangt mehr Geld; Bernhard wütet gegen eine schlampige Theaterinszenierung seiner Texte, gibt zu bedenken, dass er Rechnungen zu zahlen hat; Bernhard schimpft gegen die Scharlatanerie der zeitgenössischen Autoren, erkundigt sich nach seinen Tantiemen – wird durch Bernhards Fähigkeit, seine Wut in solch wunderbaren Sätzen zu transzendieren, dass es ein Genuss ist, diesem Misanthropen beim verbalen Kampf gegen den Literaturbetrieb zuzuhören.
Unselds Schlichtungsversuche sind ein Modell an Geduld und Diplomatie, er ist Finanzverwalter, Freund, tröstende Schulter, Butler und behutsamer Psychiater zugleich. Kurz: Er ist durch und durch Verleger. Und Bernhard zu betreuen, muss manchmal ein Vollzeitjob gewesen sein. In einem seiner berühmt-berüchtigten Wutanfälle bezeichnet Bernhard die Münchner Theateraufführung seines Textes „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ als „hundsgemeine Hinschlachtung“: „Der Vorhang ist aufgegangen und die darauf folgende Katastrophe ist mir klar geworden. So müsste es, wäre es möglich gewesen, Beethoven empfunden haben, wäre er unversehens in die Aufführung seiner Neunten oder Siebten in den Wiener Musikverein hineingeraten, in welchem eine unterbesetzte Polizeimusikkapelle spielt.“
Bernhard schlussfolgert: „[W]äre es nicht gegen das (…) hundsgemein betrogene Publikum gewesen, wäre ich auf die Bühne und hätte diese niederträchtigen Lemuren von größenwahnsinnigen Schauspielern eigenhändig umgebracht.“ Als Konsequenz fordert er, dass der Verlag keiner einzigen Bühne mehr das Recht gibt, seine Stücke aufzuführen. Es folgt ein weiteres Treffen zwischen den beiden, um die Situation zu schlichten.
Zwischen den Zeilen
Die Beziehung zwischen Verleger und Autor liest sich vor allem zwischen den Zeilen und zwischen den Briefen – hier erkennt man Bernhards als Größenwahn verschleierte Selbstzweifel, dort die behutsamen Versuche, den Autor bei Laune zu halten, weil Unseld im Endeffekt dann doch Bernhards Talent schätzt und seine Bücher den Verlag aufwerten.
In diesem (un)diplomatischen Austausch tänzeln beide immer wieder umeinander herum, machen sich heuchlerische Komplimente – Bernhard, weil er wieder mal einen Vorschuss braucht, Unseld, weil er auf das nächste Manuskript hofft. Bernhard manipuliert, kokettiert, schimpft, dass es für den Zuschauer (nicht jedoch für Unseld, der wohl jedes Mal Magenschwüre bekommen haben muss, wenn ihn wieder mal ein Brief von Bernhard erreichte – man will sich nicht vorstellen, wie das Verhältnis zwischen den beiden ausgefallen wäre, wenn sie damals schon E-Mails hätten wechseln können) eine wahre Freude ist.
Hinter jedem Wort spürt man die Doppeldeutigkeit, hinter jedem Kompliment die Drohung, hinter jedem Schlichtungsversuch die Angst, der Autor könne den Verlag wechseln – hier muss man Harald Fröhlichs (der Bernhard spielt) und Germain Wagners (der Unseld verkörpert) Leistung hervorheben, die beide in ihrer meist präzisen, nur teilweise etwas holprigen Lesung und mit wenigen Gesten die beiden Figuren mitsamt ihrer Charakterzüge hinter diesen Briefen konturieren.
Unzuverlässig
Bernhard ist dabei ein höchst unzuverlässiger Autor, die Kluft zwischen seiner verzerrten Selbsteinschätzung und der Wirklichkeit ist fast unüberbrückbar – am 22. Juli 1968 meint Bernhard, er würde seinen Verleger im Gegensatz zu anderen Autoren nur äußerst selten mit Briefen belästigen, und in seinem letzten Brief an Unseld schreibt er gar, er wäre „einer der unkompliziertesten Autoren, die [Unseld] je gehabt habe“.
Die Briefe ergeben einen Umriss der Figur des Schriftstellers, seiner Selbstzweifel, aber auch seiner wirtschaftlich prekären Situation – irgendwann meint Bernhard, er würde weniger verdienen als ein Nachbar, der in einem Bergwerk arbeitet. Denn wenn sich Künstler, wie es aus dem überspitzten Wilde-Zitat hervorgeht, so oft über Geld unterhalten, liegt dies doch daran, dass die Einkommen des Künstlers, im Gegensatz zu denen von Beamten oder Angestellten in der Privatwirtschaft, genauso unbeständig wie Bernhards Launen sind.
Die musikalische Begleitung von Cathy Krier, die u.a. Stücke von Mozart, Beethoven, Schubert und Ligeti spielt, ist zwar technisch einwandfrei und setzt dem Wechsel auch die nötige ironische Pointe auf, indem sie die Momente lyrischer Dramatik als selbstbezogene Ego-Show enttarnt, vielleicht ist die Musikwahl aber mit Momenten etwas zu offensichtlich und unterstreicht die Launen und Stimmungen zu deutlich. Davon abgesehen ist Regisseurin Marion Rothhaars Textauswahl vortrefflich – hier wurden 500 Briefe und 800 Seiten Text auf ein dramaturgisch intelligent strukturiertes Schauspiel von 90 Minuten zusammengeschnitten, das zwischen Komödie, Sittendrama und Farce hin- und herpendelt.








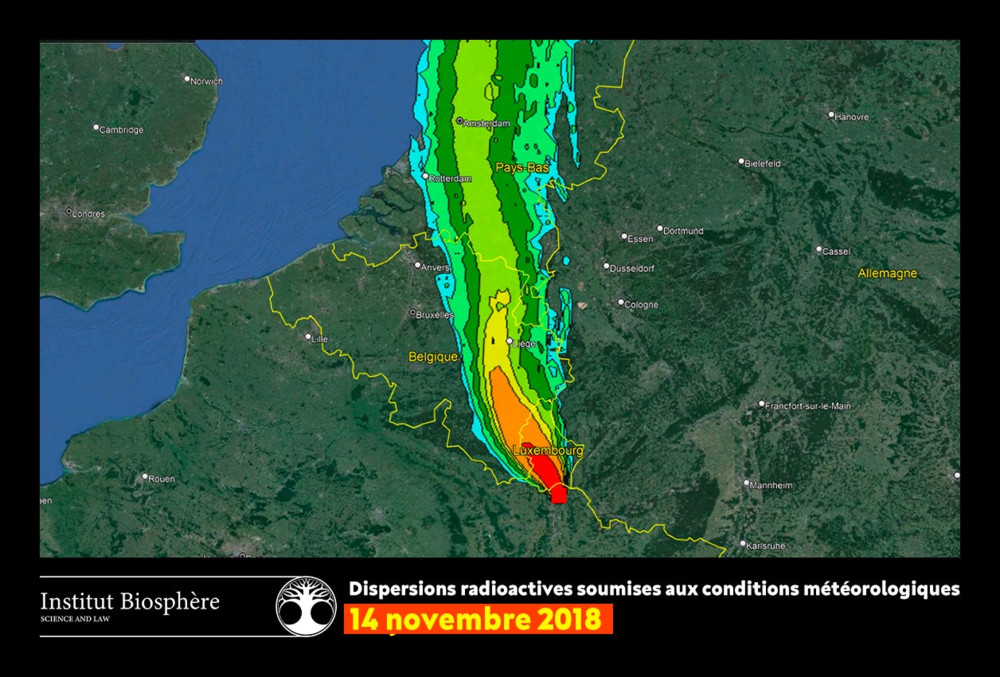

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können