Das Ergebnis des ersten Wahlgangs hätte knapper nicht sein können. Sowohl der Neoliberale Daniel Noboa als auch seine Mittel-links-Herausforderin Luisa González kamen auf rund 44 Prozent der Stimmen unter den insgesamt 16 Kandidaten: mit einem leichten Vorsprung des bisherigen Staatsoberhauptes. Am kommenden Sonntag, 13. April, sind wieder mehr als zwölf Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, zu entscheiden, wer in den kommenden vier Jahren die Geschicke des Landes leiten soll.

Der 37-jährige Präsident ist Sohn des Bananen-Barons Álvaro Noboa, des reichsten Mannes des Landes, dessen Vermögen auf mehr als eine Milliarde US-Dollar geschätzt wird. In seiner knapp anderthalb Jahre dauernden bisherigen Amtszeit hat er auf der ganzen Linie versagt: Er erhöhte die Mehrwertsteuer und kürzte im sozialen Sektor, während eine Energiekrise von September bis Dezember des vergangenen Jahres das ganze Land bis zu 14 Stunden täglich lahmlegte und ihm nichts dazu einfiel.
Noboa glänzte vorwiegend durch Tatenlosigkeit. Außer dass er vor einem Jahr die mexikanische Botschaft in Quito stürmen ließ, um den früheren Vizepräsidenten Jorge Glass zu verhaften. Kaum hatte Donald Trump 25 Prozent Zölle für Waren aus Mexiko angekündigt, erhob Noboa Zölle über 27 Prozent. Beide lateinamerikanische Staaten pflegen keine diplomatischen Beziehungen mehr zueinander.
Als das Land immer mehr in die Hände von Drogenbanden geriet, kündigte Noboa einen Krieg gegen diese an. Doch dies wurde mehr und mehr zu einem Krieg gegen die Armen. Militär und Polizei ließen unliebsame Jugendliche verschwinden. Pro Tag werden 22 Morde begangen. In den Justiz- und Sicherheitsbehörden grassiert die Korruption.
Gespaltenes Land
Derweil vertritt Luisa González die Revolución Ciudadana (Bürgerrevolution, RC), die stärkste politische Kraft Ecuadors und Partei des ehemaligen, seit einigen Jahren im belgischen Exil lebenden Präsidenten Rafael Correa (2007-2013), der in Ecuador wegen Korruption zu mehreren Jahren verurteilt wurde. Schon im Oktober 2023 verlor die heute 47-jährige Anwältin nur knapp. Doch gegen die sozialdemokratische Partei wird in den Medien vor einem kommunistischen Regime gewarnt, das zu Zuständen wie in Venezuela führen würde.

Das Land ist gespalten in Anhänger von Noboas Acción Democrática Nacional (ADN) und jene der Bürgerrevolution. Die traditionellen Parteien sind in der Marginalität versunken. Nur die Pachakutik, die politische Repräsentantin des indigenen Dachverbandes Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), kam mit immerhin 5,25 Prozent und dem dritten Platz bei den zeitgleich zur Präsidentschaftswahl ausgetragenen Parlamentswahl zu einem halbwegs ordentlichen Ergebnis.
Nun könnte die Wahlempfehlung von Conaie-Chef Leonidas Iza entscheidend sein. Die Conaie und Pachakutik berieten sich nach basisdemokratischen Prinzipien in den einzelnen Dorfgemeinschaften und sprachen sich für die Unterstützung für die RC aus. Die hauptsächlichen Differenzen zwischen den Indigenen und der Correa liegen in der Ausbeutung der Natur durch die internationalen Minengesellschaften sowie durch die Erdölförderung im Amazonasgebiet. Wenig zuversichtlich klang das, was Iza in einem Fernsehinterview sagte: „Seit der Gründung Ecuadors haben alle Präsidenten die Indigenen schlecht behandelt. Wir werden jetzt wählen, gegen wen wir in den kommenden Jahren kämpfen werden.“
Überhaupt ist aus dem einst sicheren Land das mit der höchsten Mordrate in Südamerika geworden. Im Januar 2025 wurden mit 750 so viele Morde wie noch nie in seiner Geschichte verzeichnet. Die Gewalt hat in dem etwa 18-Millionen-Einwohner-Staat, der sich in vier geografische Zonen– Pazifikküste, Andenhochland, Amazonastiefland und Galapagosinseln – aufteilen lässt, seit 2019 zugenommen. Ecuador ist zu einem Transitland für Kokain, das in den Nachbarstaaten Kolumbien und Peru angebaut wird, und damit zu einer Drehscheibe des internationalen Drogenhandels geworden.
Kampf der Kartelle
Etwa 25 Kartelle kämpfen um ihre Reviere und Schmuggelrouten. Sie untergraben das staatliche Gewaltmonopol. Selbst von den überfüllten Gefängnissen organisieren sie ihre Geschäfte und haben auch die staatlichen Institutionen infiltriert. Damit ist die Sicherheitskrise auch das Hauptwahlkampfthema. Präsident Noboa hat sich für eine Politik der harten Hand entschieden, indem er die Armee einsetzt und dabei mit der US-Sicherheitsfirma Blackwater zusammenarbeitet, Notstandsdekrete erlässt und mit Massenverhaftungen gegen die Kartelle vorgeht. Die Maßnahmen haben vor allem zur Eskalation der Gewalt geführt – und zu zahlreichen Menschenrechtsverbrechen und dem Verschwinden von Personen.
Eine Zeitlang schien sich Noboa an dem Vorbild Nayib Bukele zu orientieren, dem Präsidenten von El Salvador. Der 43-Jährige ist dabei, den kleinsten Staat Mittelamerikas komplett umzukrempeln. El Salvador, das die höchste Bevölkerungsdichte unter den mittelamerikanischen Ländern hat (Ecuador hat die höchste Südamerikas), war jahrelang als ein abschreckendes Beispiel bekannt. Es war in den Händen von Jugendbanden, den sogenannten Maras.

Schon vor Bukele antwortete der Staat mit harter Hand und sperrte die Gangmitglieder ein. Gewalt wurde mit Gegengewalt beantwortet. Die extreme Gewalt war neben der Armut für viele Salvadorianer ein Grund, zu emigrieren. Präsident Bukele hat jedoch seit seinem Amtsantritt 2019 die Macht in seinen Händen konzentriert und die Zügel noch straffer gezogen. Seither geht El Salvador neue Wege. Der nach eigenen Worten „coolste Diktator der Welt“ führte nicht nur die Kryptowährung Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ein, sondern sagte der Bandenkriminalität den Kampf an und verhängte 2022 einen Ausnahmezustand, der seither immer wieder verlängert wurde. Vor allem aber ließ er ein Gefängnis für 40.000 Menschen bauen. Zigtausend wurden oftmals aus fadenscheinigen Gründen inhaftiert.
Bukele hatte damit Erfolg: Die Zahl der Morde in dem Land verringerte sich massiv. Der Präsident wurde mit offiziell 85 Prozent der Wählerstimmen wiedergewählt, seine Partei Nuevas Ideas sicherte sich 54 von 60 Sitzen im Parlament. In den Nachbarstaaten sorgte Bukeles Vorgehen für Furore, unter anderem in Ecuador, wo Noboa darin ein Erfolgsrezept zu sehen schien, um der explodierenden Kriminalität in seinem Land Herr zu werden. Von vielen Lateinamerikanern wird Bukele laut dem Institut Latinobarómetro nicht als Diktator, sondern als Held betrachtet. Sein Vize Felix Ulloa sagte in einem Interview mit der New York Times, El Salvador werde die Demokratie eliminieren und durch „etwas Besseres“ ersetzen.
Ob Bukeles Volksknast weiter Schule macht, dürfte fraglich sein. Selbst der ihm lange zugeneigte Daniel Noboa, der nächsten Sonntag wiedergewählt werden möchte, hat sich inzwischen von der eisernen Faust des „coolsten Diktators“ distanziert. Im Interview mit der spanischen Tageszeitung El País sagte der ecuadorianische Präsident: „Unser Vorschlag ist Beschäftigung, nicht Sicherheit.“ Auf einer Veranstaltung in Madrid versicherte Noboa, der wie Bukele den Ausnahmezustand ausgerufen hatte, dass er Menschenrechte und Demokratie „zu hundert Prozent“ respektiere. Nach außen zumindest will er sich nicht die Finger schmutzig machen lassen.
Natur hat keine Priorität
In den Jahren vor dem Ausbruch der Sozial- und Sicherheitskrise hatte Ecuador übrigens mit einem umweltpolitischen Beschluss internationale Aufmerksamkeit erregt. Die Ecuadorianer hatten im August 2023 in einem historischen Referendum beschlossen, dass im Yasuní-Nationalpark in Amazonien nicht mehr Öl gefördert werden dürfe. Doch die Umsetzung hat bisher auf sich warten lassen. Bis Ende 2024 waren erst zehn der insgesamt 247 Bohrlöcher im größten Nationalpark des Landes geschlossen. Die staatliche Erdölgesellschaft Petroecuador rief zusammen mit der Regierung mehrfach das Verfassungsgericht an, um die Frist zu verschieben.
Der Schutz der Natur und der im Yasuní lebenden Indigenen hat plötzlich keine Priorität mehr. Erdölexporte sind Ecuadors wichtigste Einnahmequelle. Noboa sagt, er brauche das Geld für seinen „Krieg“ gegen die Drogenmafia. Dieser könnte, so die Befürchtung seiner Kritiker, auch zu einem schmutzigen Krieg gegen die Opposition werden.

 De Maart
De Maart











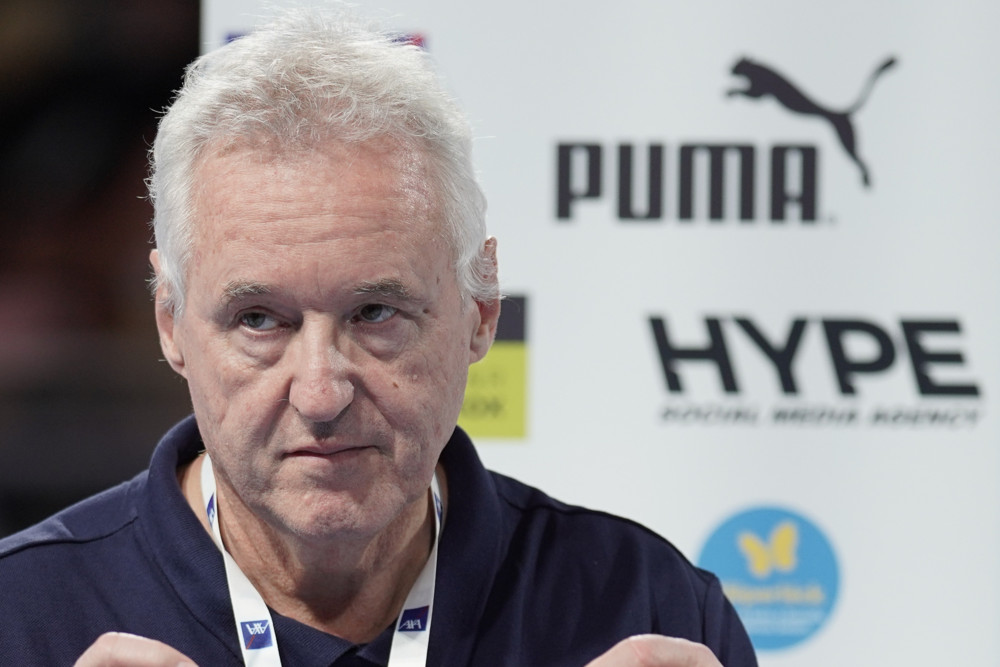



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können