Guy Stebens wirkt noch gefasst, als er vor das Tribunal tritt. Sein Anwalt Me Georges Pierret hat darauf aufmerksam gemacht, dass sein Mandant von seinem Recht Gebrauch macht, nicht auszusagen. Dennoch hat Stebens etwas zu sagen: „Ich habe mir wirklich nichts vorzuwerfen, zumindest nichts Strafbares.“ Dem 65-Jährigen stockt die Stimme und fällt es schwer, seine Erklärung zu verlesen. Er kämpft gegen die Tränen an. „Als junger Offizier habe ich bestimmt nicht alles richtig gemacht“, so Stebens, der zur besagten Zeit, um die es geht, 25 Jahre alt war. „Ich habe auf keinen Fall gelogen, in keiner Weise etwas behindert oder jemanden in Schutz genommen.“

Foto: Editpress/Hervé Montaigu
Als die Sprengstoffanschläge 1984 begannen, besuchte Stebens noch die Offiziersschule in Frankreich. Er kam dann zur Brigade Mobile der Gendarmerie (BMG). Als er mit der Leitung der Gruppe (GOR) beauftragt wurde, die im Oktober 1985 in der Bommeleeër-Affäre ermittelte, waren bereits 15 der 20 Anschläge verübt worden. Er aber besaß nicht genügend Berufserfahrung für diese Position. „Am zehnten Tag des GOR geschah etwas, das meine Karriere 20 Jahre später zerstört hat und mein Privatleben auf den Kopf stellte“, fährt Stebens fort. Es war die Zeit, als der damalige Hauptverdächtige Ben Geiben, der frühere Leiter der BMG, beschattet werden sollte. Während der Observation und des Attentats auf den Justizpalast sei er nicht im Land gewesen. Stebens war auf einem Lehrgang. „Die Beschattung ging bekanntlich komplett schief“, wirft die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ewert ein.
Nach seiner Rückkehr sei nicht mehr weiter über das Thema gesprochen worden, so Stebens. Niemand habe ihm Vorwürfe gemacht. Er sei seit Oktober 2005 unzählige Male verhört worden, insgesamt 19 Mal und insgesamt 69 Stunden lang. Er wünsche sich, dass die Affäre aufgeklärt und seine Unschuld bewiesen würde, sagt der gebrochen wirkende frühere Generalsekretär der Polizei. Dann macht er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.
Lebenseinschnitte

Es ist der erste emotionale Höhepunkt in dem mit einiger Hoffnung, was die Aufklärung der gesamten Affäre betrifft, erwarteten Prozess wegen Falschaussagen im Bommeleeër-Prozess 2013/14. Auch Pierre Reuland beruft sich auf das Aussageverweigerungsrecht. Wie sein Vorredner wirkt er, als seine Erklärung abgibt, bewegt. Er bittet um ein Glas Wasser. Dann sagt der 67-jährige frühere Polizeichef, während der Anschläge Leiter der BMG: „Im Jahr 2007 erlebte ich zwei wesentliche Einschnitte in meinem Leben. Den größten Schock erlebte ich, als ich von der Festnahme Marc Scheers und Jos Wilmes’ als Verdächtige in der Bommeleeër-Affäre erfuhr. Ich kannte die beiden am längsten. 1981 hatte ich angefangen, 1983 haben wir uns kennengelernt. Die Brigade Mobile bestand nur aus acht Personen. Wir teilten uns eine Gendarmerie-Wohnung als Büro. Wir hatten also einen Raum zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit zwei Verdächtigen die ganze Zeit verbracht habe.“
Als Scheer und Wilmes aus der Haft entlassen wurden, habe er mit ihnen einzeln gesprochen, ihnen in die Augen geschaut. Sie hätten ihm versichert, unschuldig zu sein, sagt Reuland. Deshalb habe er seine Verantwortung als Verwaltungschef ergriffen und sich hinter die beiden Beschuldigten gestellt. Den zweiten Schock habe er ebenfalls 2007 erlebt, als der Bericht des Geheimdienstes (SREL) zur Beschattung Geibens publik wurde. „Es stand genau drin, was geschehen war, auch eine Aufzählung der Leute, die an der Beschattung teilgenommen hatten“, sagt Reuland. „Ich stand nicht auf der Liste, ich wusste von der Observation nichts.“ Darüber hinaus kann er belegen, dass er sich in jener Woche im Ausland aufgehalten habe. Mit dieser Überezeugung sei er auch 2013 in den Prozess gegangen.
Ich bin nicht der Bommeleeër, ich kenne den Bommeleeër nicht, und ich habe nichts zu verheimlichen
Der Angeklagte dreht sich um, zeigt auf Scheer und Wilmes, die beiden Angeklagten im 2014 auf Eis gelegten Bommeleeër-Prozess. Bis heute sei er von deren Unschuld überzeugt, sagt er, und betont: „Die zwei da waren es nicht. Und ich war auch nicht dabei.“ Reuland wirft die Frage auf, warum er lügen solle. Und sagt weiter: „Ich bin nicht der Bommeleeër, ich kenne den Bommeleeër nicht, und ich habe nichts zu verheimlichen.“ Als ihn die Vorsitzende Richterin auf seine früheren Äußerungen gegenüber dem damaligen Substitut principal Robert Welter hinweist, bei dem er sich nach einer Sitzung über die Ermittlungen in der Affäre erkundigt und demgegenüber er gesagt habe, dass bei einem „gewëssene Niveau“ Schluss sei, und auf höhere Ebenen verwiesen hätte, sagt er, dies könne auch ein „Bistrotgespräch“ sein.
Auch der frühere Sûreté-Chef Armand Schockweiler macht von dem bereits genannten Recht Gebrauch, nicht auf weitere Fragen zu antworten. Er habe immer die Wahrheit gesagt, so der 70-Jährige. Auch er könne sich nichts vorwerfen. In Bezug auf das Rechtshilfeersuchen in Brüssel erklärt er, dass das Ziel gewesen sei, herauszufinden, mit wem Geiben dort Kontakt hatte. Weil Geiben von der Observation Wind bekam, sei diese gescheitert. „Die Ermittler von heute brachten es nicht fertig, sich in die Situation von damals hineinzuversetzen“, so Schockweiler, „die Gendarmerie ist damals anders gewesen als die heutige Polizei, auch die Ermittlungsarbeit verlief anders“. Man sei anders vorgegangen. So sei damals der Fehler gemacht worden, dass nichts dokumentiert wurde. „Alles lief mündlich“, erklärt er, „auch in anderen großen Affären.“ Irgendwann sei der Punkt gekommen, an dem niemand mehr an die Spur Geiben geglaubt hätte, erinnert sich Schockweiler.
Auf ein Glas mit Geiben

Zuvor ist der frühere Sûreté-Beamte Guillaume Büchler nach vorn gerufen worden. Er hatte 2003 ausgesagt, seine beiden Kollegen Paul Haan und Lucien Linden seien in Brüssel zufällig auf Geiben getroffen. Im Prozess 2013/14 dementierte er dies jedoch. „Es ist mir unerklärlich, warum ich diese Aussage gemacht habe“, sagt er jetzt. „Wahrscheinlich habe ich die Erklärung nicht genau gelesen. Vielleicht hat das etwas mit einer Unterzuckerung zu tun gehabt.“ Der 76-Jährige erklärt, er sei bereits damals Diabetiker gewesen. Generell sei er nicht wirklich in die Ermittlungen involviert gewesen, und für eine derart komplexe Observierung wie die Geibens sei er nicht ausgebildet gewesen. Jedenfalls sei er Geiben in Brüssel nicht begegnet. Wenn dies der Fall gewesen sei, „dann wären wir etwas trinken gegangen“, fügt er hinzu. Etwa in diesem Wortlaut hatte Geiben im Dezember 2004 ausgesagt, er habe abends in Brüssel auf dem Weg zur Arbeit zufällig Büchler und Haan gesehen und sich mit diesen geeinigt, ein Glas trinken zu gehen.
Während Me André Harpes, Sohn und Verteidiger des 97-jährigen Angeklagten Colonel Aloyse Harpes, bekundet, dass sein Mandant und Vater körperlich nicht mehr in der Lage sei, auszusagen, erklärt das frühere BMG-Mitglied Marcel Weydert, der im Bommeleeër-Prozess aussagte, auf einem Foto zusammen mit Marc Scheer abgebildet gewesen zu sein: „Ich bin mir mittlerweile bewusst, dass das eine Fehleinschätzung war.“ Vielleicht sei dies auf die Medienberichte zurückzuführen gewesen. „Ich habe mich selbst bloßgestellt.“ Mehrfach an diesem Prozesstag ist angeklungen, dass es sich Mitte der 80er Jahre um eine andere Zeit in der Ermittlungsarbeit der Polizei handelte. Doch es war eine Zeit, die bis heute eine Rolle spielt.
Am Mittwoch werden die Nebenkläger gehört, etwa Scheer und Wilmes, am Donnerstag soll die Staatsanwältin Dominique Peters die Anklage vortragen.


 De Maart
De Maart



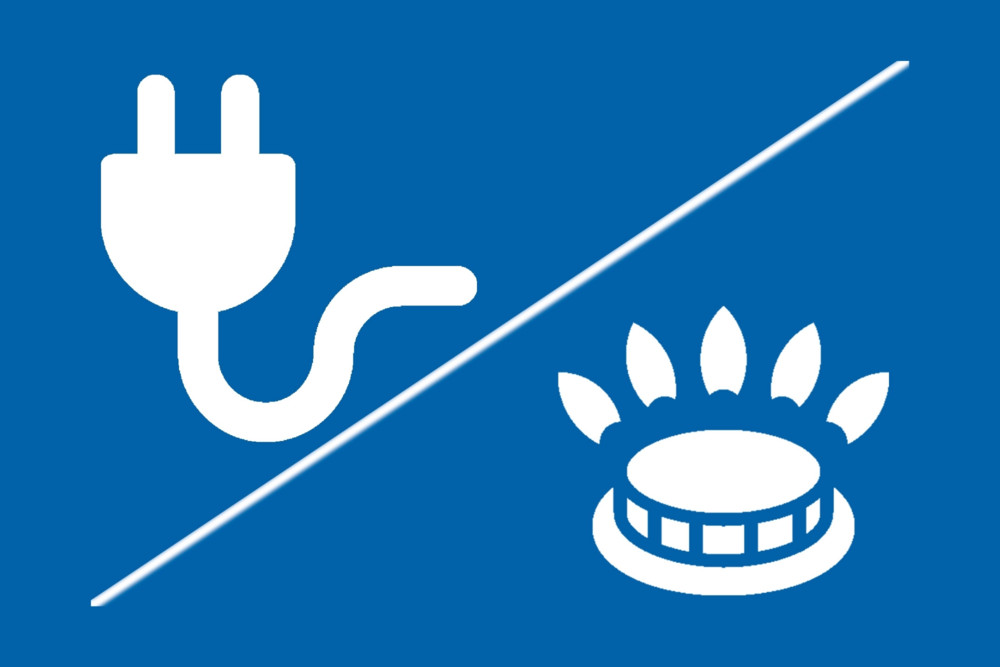





> Mehrfach an diesem Prozeßtag ist angeklungen, daß es sich Mitte der 80er Jahre um eine andere Zeit in der Ermittlungsarbeit der Polizei handelte. Doch es war eine Zeit, die bis heute eine Rolle spielt (…) Bei der Lektüre des Buches von Herrn Peter SANDNER wurde ich an eine Tatsache erinnert, die ich im Laufe der Jahre aus den Augen verloren hatte. Ich habe sie mit "PDV" (Priorität der Verwaltung) getaggt. Zwei markante im Buch erwähnte Beispiele: (Seite 707) (…) Am Beispiel des Bezirksverbandes (Hessen - Nassau) lassen sich vereinzelt Initiativen von Beamten festmachen, die - wie HILBERG es ausdrückte - wußten, "für welche Entscheidungen die Zeit herangereift war" und die dann "eine Maßnahme einleiteten". Ein derartiges Verhalten traf hauptsächlich zu auf einige Leitungskräfte in der Zentralverwaltung des Verbandes und auch auf exponierte Mitarbeiter in den Anstalten. Bei den "normalen", mittleren Beamten und Angestellten der Zentralverwaltung des Verbandes hat man aber kaum von einer größeren Eigeninitiative auszugehen, die zur Umsetzung des Massenmordes entscheidend gewesen wäre. Schon gar nicht werden hier "Schreibtischtäter" erkennbar, die "inspiriert gewesen wären von einem faustischen Erlebnishunger und durchdrungen von dem berauschenden Gefühl, Geschichte zu schreiben", wie es BROWNING für die "bürokratischen Kader" beim Judenmord postuliert. Weitaus häufiger und mindestens ebenso wichtig für die reibungslose Umsetzung des Massenmordes war nämlich nicht die begeisterte Eigeninitiative, sondern die "routinemäßige" und vermeintlich "unschuldige" Mitwirkung der Beamten und Angestellten im arbeitsteiligen System der Verwaltung. Begünstigend wirkten hier "die zentralistisch organisierten Verwaltungsstrukturen und das streng hierarchisch gegliederte Beamtentum, bei dem niemand in eigener Verantwortung handelte, sondern stets nur 'im Auftrag' ". Indem die Mordaktion insgesamt "in eine Vielzahl scheinbar unbedeutender Einzelhandlungen unterteilt worden" war, mußte - so CORDING - "niemand sich für das Ganze verantwortlich fühlen". (Anmerkung 74) (…) Eine Verwaltung wie die des Bezirksverbandes beschränkte sich nicht darauf, "den fundamentalen Unrechtscharakter der führerstaatlichen Herrschaft zu kaschieren", sondern sie wurde selbst ein Akteur dieses Unrechtsstaats. Da bei den Euthanasieverbrechen "letztlich die Parteiideologen und Bürokraten die Arbeitsweise und die Entscheidungsabläufe bestimmten" und dies nicht den Ärzten überließen, konnten sie für eine noch effizientere und umfassendere Umsetzung der Mordabsicht sorgen. (Anmerkung 79) (…) Mit diesen beiden Beispielen weise ich lediglich auf strukturelle Tatsachen hin. Diese sind aber meiner Meinung nach wichtig um den luxbg. (Nachkriegs)staat zu verstehen. MfG, Robert Hottua, ein zum Thema "anonyme Verantwortungslosigkeit" sensibilisierter Luxemburger Bürger