Es dürfte, seit der Amtsübernahme des US-Präsidenten Donald Trump Anfang Januar und dessen radikalem Wandel in der US-Außen-und Sicherheitspolitik, das vorläufig letzte von vielen Gipfeltreffen gewesen sein, das die EU- und andere Staaten in verschiedenen Zusammensetzungen in den vergangenen Wochen zusammengebracht hat. Doch längst ist nicht alles geklärt, vieles beginnt nun erst. Denn die EU-Staaten wollen in den kommenden Jahren aufrüsten. Dazu wurde noch am Vortag des Gipfeltreffens ein bereits im Herbst angekündigtes Weißbuch über die Zukunft der europäischen Verteidigung vorgelegt, das quasi die Anleitung dazu liefern soll, wie sich die EU künftig militärisch aufstellen soll. Denn die EU-Staats- und Regierungschefs wähnen den Kontinent in unsicheren Zeiten, nachdem Russland einen vollumfänglichen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Vor allem aber auch, nachdem Donald Trump den Europäern unmissverständlich zu verstehen gegeben hat, dass im Ernstfall kein Verlass auf die USA sein könnte.
Doch in erster Linie wird Putins Russland als eine reale Bedrohung wahrgenommen. Das bestätigte am Donnerstag auch der luxemburgische Premierminister Luc Frieden: „Wir können das Risiko weiterer Angriffe Russlands nicht ausschließen. Und deshalb rüsten wir auf, nicht um einen Krieg zu führen, sondern um abschreckend zu wirken.“ Europa müsse auf seinen „eigenen Beinen stehen“, so der Premier weiter, um jedoch sogleich zu ergänzen, dass es auch darum gehe, innerhalb der NATO ein „starker europäischer Pfeiler“ zu werden. Denn so ganz wollen und können die Europäer nicht auf den Beistand der USA in der transatlantischen Allianz verzichten. In ihrer Schlusserklärung geben sich die 27 das Ziel, „die Verteidigungsbereitschaft Europas innerhalb der nächsten fünf Jahre entscheidend zu erhöhen“.
Wie bei vorherigen Gipfeln nahm ebenfalls der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschalte an dem Treffen teil. Er rief die EU-Staats- und Regierungschefs unter anderem dazu auf, die Sanktionen gegen Russland beizubehalten. Denn es besteht die Befürchtung, dass Putin in seinen Gesprächen mit Trump über eine Waffenruhe das Ende der Sanktionen einfordert, worauf der US-Präsident zum schnellen Erreichen seiner Ziele eingehen könnte. Doch in der EU wird daran nicht gedacht, im Gegenteil. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda etwa forderte, den Druck auf Russland mit einem 17. Sanktionspaket weiter zu erhöhen. Und forderte dazu ein Ende der Importe von russischem Flüssiggas.
Die Finanzierung der Verteidigungsausgaben
Derweil soll die Ukraine weiter unterstützt werden. So regte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas an, dem Land für fünf Milliarden Euro großkalibrige Artilleriemunition zukommen zu lassen. „Je stärker sie auf dem Schlachtfeld sind, umso stärker sind sie am Verhandlungstisch“, meinte Europas Chefdiplomatin, die ursprünglich ein neues militärisches Hilfspaket in Höhe von 40 Milliarden Euro für Kiew vorgeschlagen hatte, das jedoch in der Gipfelschlusserklärung nicht erwähnt wird.
Diskutiert wurde ebenfalls die Finanzierung der Wiederbewaffnung Europas, wozu die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vergangene Woche einen Finanzierungsplan vorgelegt hatte, „ReArm Europe“. Der Name würde ihm nicht gefallen, meinte der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und fuhr unumwunden fort, dass er eine andere Perspektive auf die Sicherheit habe, die sich von der der östlichen Mitgliedstaaten unterscheide. Insgesamt 800 Milliarden Euro sollen mit den Vorschlägen der Kommissionschefin in den kommenden Jahren für Verteidigungsausgaben mobilisiert werden können. Davon allein 650 Milliarden Euro durch die Lockerung der Schuldenregeln im Rahmen des Stabilitätspaktes. Allerdings kommt diese Summe nur zusammen, wenn alle EU-Staaten das dadurch vergrößerte Schuldenlimit voll ausschöpfen. Neues Geld oder gar Zuschüsse gibt es auch keine von dem 150 Milliarden Euro umfassenden Finanzinstrument, das die EU-Kommission auflegen will. Auch hier handelt es sich lediglich um Kredite, die den EU-Staaten bereitgestellt werden sollen, sofern sie bestimmte Kriterien bei der Beschaffung von neuem militärischem Material einhalten. So sollen sich die EU-Staaten zusammen tun und europäische Rüstungsunternehmen bevorzugen.
Auch wenn die Kredite der Kommission für manche EU-Staaten günstig sind, meinte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis dennoch, dass die EU zur Finanzierung der gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen Schulden in Form von Eurobonds aufnehmen sollte. Was allerdings sowohl vom scheidenden deutschen Kanzler Olaf Scholz als auch vom niederländischen Regierungschef abgelehnt wurde. „Wir sind gegen Eurobonds. Das ist nicht neu“, sagte Dick Schoof knapp. Dennoch brauche es mehr Finanzmittel, wie die lettische Regierungschefin Evika Silina meinte, die darauf hinwies, dass ihr Land mittlerweile 3,65 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufwende. Dieses Geld für die europäische Verteidigungsindustrie könnte auch bei privaten Anlegern aufgetrieben werden, meinte die Lettin.
Frieden verteidigt Finanzplatz
Dabei kommt ein weiterer Tagespunkt des Gipfeltreffens ins Spiel, die sogenannte „Spar- und Investitionsunion“ (SIU), die ebenfalls am Mittwoch von der EU-Kommission vorgestellt wurde. Die vormals als Kapitalmarktunion bezeichnete SIU soll das Geld der EU-Sparer für Investitionen in die europäische Wirtschaft mobilisieren. Das ist vor allem auch eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit der EU. An die 10.000 Milliarden Euro hätten die EU-Bürger auf der hohen Kante liegen, die zwar sichere, aber im Vergleich zu den Möglichkeiten auf den Kapitalmärkten eher geringere Renditen abwerfe würden, so die EU-Kommission. Um die Anlegetätigkeit der Euro-Sparer zu fördern, müssten Barrieren abgeschafft und der Kapitalmarkt vereinfacht werden. Ein Kapitalmarkt mit gemeinsamen Regeln könnten dabei helfen.
„Ich begrüße und unterstütze die Spar- und Investitionsunion“, sagte Luc Frieden in Brüssel. Er sei auch für eine Vereinfachung und gemeinsame Regeln. Allerdings wehrt er sich gegen das Ansinnen der EU-Kommission, die Überwachung der Regeln einzig und allein der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA mit Sitz in Paris zu übertragen. Denn in Luxemburg wird davon ausgegangen, dass das negative Konsequenzen für die hiesige Fondindustrie hätte. Frieden plädiert vielmehr dafür, die Überwachung einem Netzwerk von „Exzellenz-Zentren“ zu überlassen, die in Ländern wie Irland, Luxemburg und anderen Ländern bestünden und sich in der Materie auskennen würden. Auch verschließe er sich nicht einer „europäischen Konvergenz und Kooperation“, doch er wolle „pragmatisch“ an die Sache herangehen, so Luc Frieden.

 De Maart
De Maart





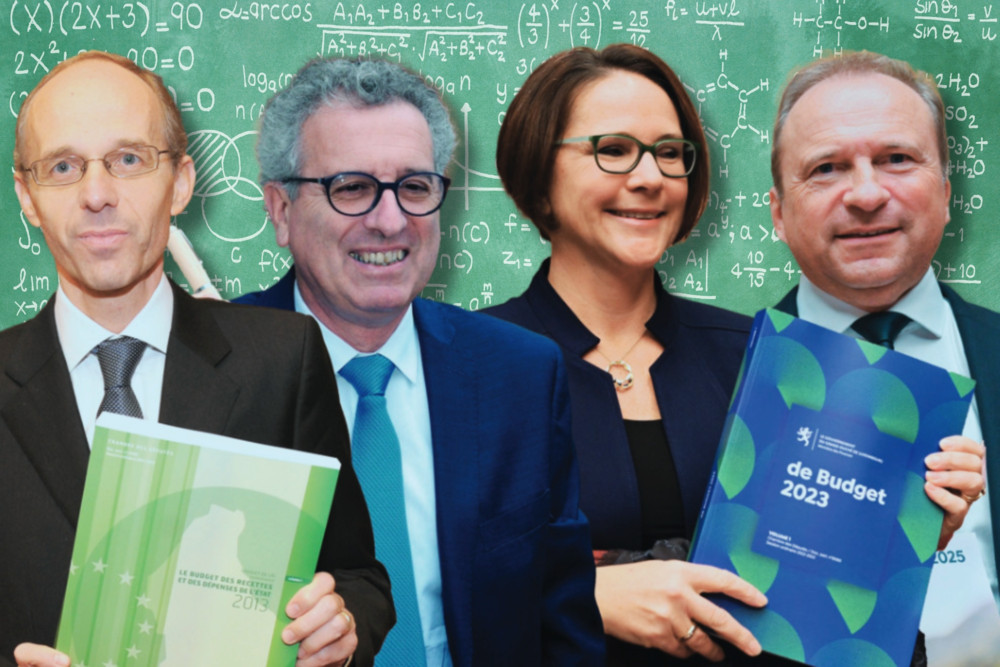



Die Schuldenphantasien der von der Leyen und CO scheinen keine Grenzen mehr zu kennen . Ist aber nicht so schlimm , denn die EU ist schon laengst trotz der EU Vertraege zur Schuldenunion verkommen .