Sträucher wuchern in der stillen Stadt aus Fensterhöhlen und auf Dächern. Von einst über 36.000 Einwohnern ist die Bevölkerung der Kommune Srebrenica seit dem Bosnienkrieg (1992-1995) auf rund 4.000 Seelen geschrumpft. Im eigentlichen Stadtgebiet leben heute gerade noch einmal 1.000 Menschen – ein knappes Zehntel der Vorkriegsbevölkerung.
Ob das kroatische Vukovar oder Knin, das bosnische Srebrenica, Mostar oder Sarajevo, ob wiederaufgebaut, von Rückkehrern und Flüchtlingen neu besiedelt oder wieder verlassen: Nicht nur den während der Jugoslawienkriege der 90er Jahre besonders hart umkämpften Städten und Regionen machen deren Folgen noch immer zu schaffen. In der endlosen Nachkriegszeit des zerfallenen Vielvölkerstaats ist ein echter und gemeinsamer Neuanfang ausgeblieben: 30 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica belastet die Kriegsvergangenheit noch stets die Beziehungen der ex-jugoslawischen Staaten und Völker.
Der Krieg ist in Bosnien und Herzegowina schon seit drei Jahrzehnten vorbei, und dennoch steht der Vielvölkerstaat symptomatisch für eine Region ohne echte Aussöhnung: Mehr neben- als miteinander scheinen sich die ex-jugoslawischen Völker eher auseinander zu leben als sich einander anzunähern.
Nicht nur in Ostbosnien haben die „ethnischen Säuberungen“ des Krieges ihre Spuren hinterlassen – und die bereits in den 70er Jahren begonnene Landflucht beschleunigt. Von den Flüchtlingen sind meist nur die Alten in ihre Dörfer zurückgekehrt. Ihre Kinder haben hingegen oft weder an einem Leben als Landwirt noch in einer feindlich gesinnten Umgebung Interesse.
Nationalistische Mythen und Propaganda
Nationalistische Politiker und Medien halten grenzüberschreitend und vor allem zu Wahlzeiten mit dem Schüren von Vorurteilen die Urängste vor einem erneuten Waffengang am Leben. Jede Nation wird von ihren Würdenträgern in erster Linie als Opfer dargestellt. Oft werden nur die an der eigenen Nation begangenen Kriegsverbrechen beklagt, das Leiden der anderen ausgeblendet und heruntergespielt oder gar die Untaten heimischer Kriegsschergen verherrlicht.
Die Zeiten, in denen beispielsweise die damaligen Präsidenten Kroatiens und Serbiens 2010 bei einem gemeinsamen Besuch des Gedenkfriedhofs in Vukovar die Versöhnungsannäherung versuchten, liegen lange zurück. Unversöhnliche Kriegstöne, nationalistische Mythen und Propaganda von Würdenträgern und Regierungsmedien verfangen gerade auch bei Jüngeren, die kaum mehr eine Erinnerung an Jugoslawien und das Leben im gemeinsamen Staat haben.
Als faschistische „Ustaschas“ pflegen serbische Würdenträger und Boulevardmedien nicht nur Kroaten an sich zu verunglimpfen, sondern auch heimische Regierungskritiker. Umgekehrt jubelten über eine halbe Million Kroaten am Wochenende in Zagreb dem nationalistischen Kriegsbarden Marko Perkovic „Thompson“ zu, als er bei seinem Großkonzert gemeinsam mit seinem Publikum wieder einmal den eigentlich verbotenen Gruß der Ustascha deklamierte: Begeistert brummten selbst Minister dessen unversöhnliche Kriegsoden über in die Flucht geschlagene Serben mit.
„Jugosphäre“ und „Adria-Liga“
Doch auch im ex-jugoslawischen Vielvölkerlabyrinth sprechen und finden normale Leute immer eine gemeinsame Sprache. Egal, ob im Urlaub am Adria-Strand, bei grenzüberschreitenden Familienfreiern, Geschäftstreffen oder Wissenschaftskonferenzen: Gerade private Begegnungen von Menschen der vermeintlichen „Erzfeinde“ Kroatien und Serbien sind oft besonders herzlich.
Die sogenannte „Jugosphäre“ lebt besonders unter den Kulturschaffenden der Nachfolgestaaten: Deren Basketballer gehen selbst noch in einer gemeinsamen „Adria-Liga“ auf Punktejagd. Doch drei Jahrzehnte des weitgehend getrennten Alltags in sieben Nachfolgestaaten lassen auch ihre Spuren zurück. Die Kenntnis übereinander schwindet genauso wie die gemeinsame Erfahrungswelt.
Junge Slowenen und Kroaten sind heute eher in Richtung der EU-Partner orientiert – und haben Städte wie Belgrad, Sarajevo oder Skopje oft noch nie besucht. Serben wiederum reisen im Urlaub heute eher nach Griechenland als an die kroatische Adriaküste, Kosovaren eher nach Albanien als nach Montenegro. Bei weniger Gelegenheit gibt es auch weniger Liebe: Die Zahl der sogenannten „gemischten“ Ehen ist seit dem Zerfall Jugoslawiens kräftig geschwunden.

 De Maart
De Maart





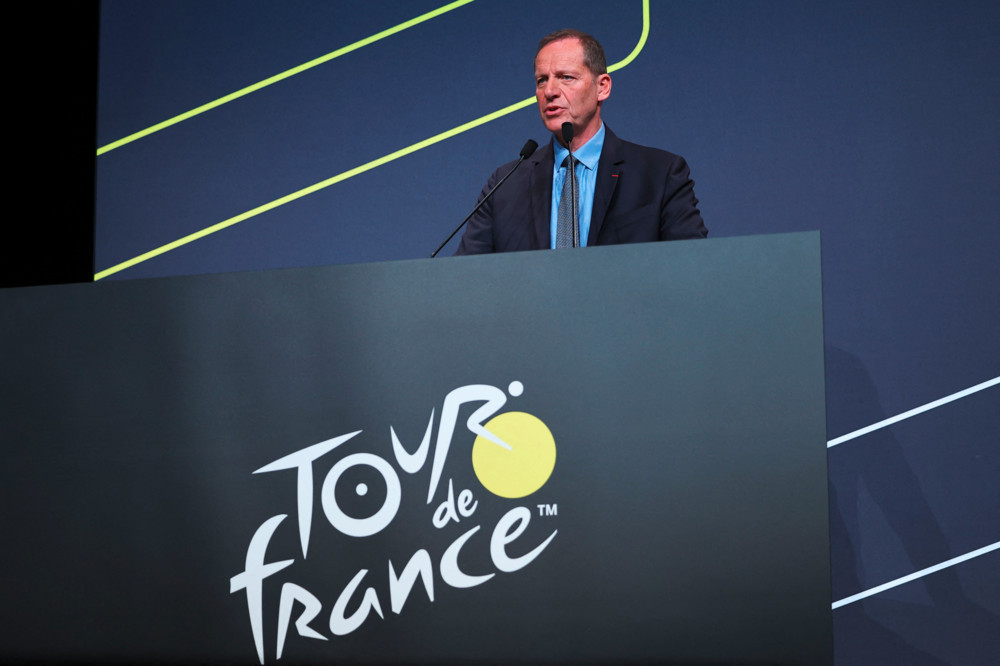

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können