Interview: David Thinnes
Das Tageblatt hat sich vor diesem Termin mit dem 66-Jährigen unterhalten. Durch seine vielfältigen Aktionen und Aussagen – zum Yeti, zu nachhaltigem Tourismus oder zum Tod seines Bruders Günther am Nanga Parbat 1970 – wurde er zum berühmtesten, aber auch umstrittensten Bergsteiger aller Zeiten.
Tageblatt: Herr Messner, Sie reden heute über nachhaltigen Tourismus. Was ist nachhaltiger Tourismus für Sie?
Reinhold Messner: „Nachhaltiger Tourismus findet dort statt, wo die lokale Landschaft, Kultur, Architektur so genutzt wird, dass sie auch in 1.000 Jahren noch besteht und Spannung hat. In den Alpen haben wir ein Dilemma: Ein großer Teil ist ungenutzt, so dass Überleben nicht möglich ist und die Menschen weggehen müssen. Ein anderer Teil ist ‚übernutzt‘: Dort sehen und erfahren die Touristen etwas, das den Alpen nicht entspricht“
Marktnische entdeckt
„T“: Einen 8.000er kann man mittlerweile im Katalog bestellen. Was halten Sie von Anbietern wie dem Neuseeländer Russell Brice oder dem Schweizer Kari Kobler, jeden auf den Everest zu bringen?
R.M.: „Diese Leute haben eine Marktnische entdeckt. Allerdings sind sie nicht die Erfinder. Aber sie bauen den Touristen eine Piste auf den Everest und führen sie hinauf. Deswegen nenne ich den heutigen Alpinismus Pisten-Alpinismus. Aber ich wiederhole auch: Der Alpinismus beginnt dort, wo der Tourismus aufhört. Das ist und bleibt Tourismus. Und wenn der Öffentlichkeit das endlich klar ist, wird dieser Hype auch nachlassREINHOLD MESSNER STECKBRIEF
o Geboren am 17. September 1944 in Brixen (Italien)
o Als Fünfjähriger besteigt er mit seinem Vater seinen ersten 3.000er
o Der gelernte Geometer arbeitete kurz als Mittelschullehrer, ehe er sich dem Bergsteigen verschrieb.
o 1950-1964: 500 Klettertouren in den Ostalpen, vor allem in den Dolomiten
o 1965-1969: verschiedene Begehungen in Europa und den Anden
o zwischen 1970 und 1986: Besteigung der 14 8.000er
o 1989/90: Antarktis-Durchquerung zu Fuß (2.800 km)
o 1992: Durchquerung der Wüste Taklamakan (zweitgrößte Sandwüste der Welt) zu Fuß
o 1993: Längs-Durchquerung Grönlands zu Fuß
o 1995: Arktis-Durchquerung gescheitert
o 1999-2004: Messner vertrat die italienischen Grünen im Europäischen Parlament
o 2003: Messner beginnt die Arbeit an seinem Bergmuseum. 2006 eröffnet das Messner Mountain Museum (MMM). Mittlerweile gibt es fünf MMM: Firmian, Ortles, Dolomites, Juval, Ripa
o 2004: Längs-Durchquerung (2.000 km) der Wüste Gobi (fünftgrößte Wüste der Welt) zu Fuß
o zwischen 1970 und 2010: Veröffentlichung von etwa 70 Büchern
o Messner ist vierfacher Vater und lebt in Meran und auf Schloss Juval in Südtirol
o Internet:
www.reinhold-messner.iten. Solange ich das Bergsteigen verkaufen kann als ’ich habe den Everest bestiegen und damit einen Rekord erreicht’ und niemand fragt, wie das gemacht worden ist, werden weiter Tausende von Sekretärinnen – ich habe nichts gegen Sekretärinnen – und wild gewordene Spießer zum Everest laufen. Ob das für die Sherpas (Himalaja-Volk, einheimische Bergführer, d. Red.) schlau ist, den Everest so auszuverkaufen, lasse ich dahingestellt. Ich glaube, es ist auf Dauer nicht schlau, auch touristisch nicht. Früher oder später wird der Everest seine Anziehungskraft verloren haben. Dann ist kein nachhaltiger Tourismus mehr möglich.“
„T“: Vor vier Jahren gab es große Diskussionen um David Sharp: Der britische Bergsteiger verstarb 450 m unter dem Everest-Gipfel. Der Vorwurf kam auf, dass Sharp zum Sterben liegen gelassen wurde. Rettungen in solch großer Höhe gelten in Bergsteiger-Kreisen als so gut wie unmöglich, auch und vor allem aus Gründen des Eigenschutzes. Vor allem Russell Brice stand in der Kritik.
R.M.: „Ich werde keine Urteile fällen. Generell bin ich der Meinung, dass es nicht zu verantworten ist, Leute auf den Everest zu bringen. Das klassische Bergsteigen hat mit Eigenverantwortung zu tun. Wenn jemand in Eigenverantwortung auf den Berg steigt, ist er selbst schuld, wenn er dabei umkommt. Wenn ich jedoch eine Infrastruktur zum Gipfel des Everest baue, dann trage ich auch eine juristische Mitverantwortung. Und das ist bisher nicht klar ausgedrückt worden. Natürlich macht Russell Brice einen Vertrag mit den Leuten, dass sie die Verantwortung tragen. Alleine dieser Vertrag ist der Beweis, dass er etwas tut, das im Grunde nicht ganz sauber ist.“
Popularität des Bergsteigens
„T“: Sind Sie denn nicht in einem gewissen Sinn mit verantwortlich für die Popularität des Bergsteigens, speziell des Höhen-Bergsteigens?
R.M.: „Das schließe ich nicht aus. Ich bin derjenige, der weltweit klargemacht hat, dass es 14 dieser Gipfel gibt. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Allerdings habe ich Wert auf die Art und Weise gelegt. Wenn die Leute so nachgestiegen wären, wie ich das vorgemacht habe, hätten wir den Massentourismus an den großen Bergen nicht. Man hat nur den Hype kopiert.Wenn man jetzt die Frauen – die die 14 8.000er erklimmen wollen – sieht und über die ich gerade ein Buch geschrieben habe (On Top – Frauen ganz oben, d. Red.), sieht man, dass es nur um das Erreichen der Gipfel geht und nicht um das Wie, nicht um das Erlebnis.“
„T“: Die Koreanerin Oh Eun-Sun hat in diesem Jahr als erste Frau die „Sammlung“ aller 14 8.000er komplett gemacht. Sie waren mit der einzige, der Ihr gratuliert hat.
R.M.: „Niemand hat mit der Frau geredet, sie wurde nur kritisiert. Es wurde behauptet, sie hätte den Hubschrauber benutzt, um ins Basislager zu kommen; Sauerstoff genutzt; Sherpas hätten sie gezogen und ihren Rucksack getragen. Die einzige Geschichte, die fraglich ist, ist der Gipfelgang am Kangchendzönga (8.598 m, d. Red.). Sie sagt selbst, dass sie in Gipfelnähe gestiegen ist. Sie hat nie behauptet, dass sie auf dem Gipfel war. Beim letzten Felsen ist sie stehen geblieben, in absoluter Gipfelnähe. Die Erstbesteiger haben das auch getan, aus Respekt vor den Göttern. Sie hat es getan, weil oben so ein starker Wind war, dass es sie runtergeweht hätte. Für mich gilt die Besteigung, wenn sie so ist, wie sie es beschreibt. Warum sollte ich etwas anderes annehmen, wenn ich es nicht beweisen kann? Und zu den anderen Aussagen: Den Hubschrauber ins Basislager hat sie nur einmal benutzt, alle anderen Damen (Edurne Pasaban und Gerlinde Kaltenbrunner, d. Red.) öfters. Sauerstoff setzen Männer auch teilweise ein. Sie hatte dieselben Pisten wie andere auch zum Gipfel. Der Unterschied besteht darin, dass sie alles ganz ehrlich beschreibt, und das hat die anderen auf die Palme gebracht. Weil sie alle so tun, als ob sie im Alpin-Stil an den Bergen klettern. Das ist absolut erfunden.“
„T“: Müssen Bergsteiger Egoisten sein?
R.M.: „Alle Bergsteiger müssen Egoisten sein. Was wir tun, ist einer Familie gegenüber im Grunde kaum zu vertreten. Wir müssen einsehen, dass wir etwas Gefährliches tun. Wir setzen uns den Gefahren freiwillig aus. Solange wir die Verantwortung für uns selber tragen, ist das okay. Das Ganze infrage zu stellen, ist, wenn man die Verantwortung für andere mitträgt. Diese Machos, die entscheidungsfreudig, mutig, heldenhaft sein wollen, die kommen mit mir nicht zurecht. Eine Frau, oder Mutter, die auf den K2 steigt, ist nicht mehr zu kritisieren als ein Mann, der auch Kinder zu Hause hat. Die Frau ist nicht die Rabenmutter, und der Mann nicht der Held, wenn sie bergsteigen.“
„T“: Welchen Platz nimmt die Angst ein?
R.M.: „Gefahren lösen Angst aus. Und wenn ein Bergsteiger keine Angst hat, lebt er nicht lange. Glauben sie keinem, der sagt, er hätte keine Angst. Das ist Wunschdenken. Die Angst ist mit dem Können kontrollierbar. Die Angst kann ich nur kleiner machen, wenn ich besser bin.“
Lernphasen beim Bergsteigen
„T“: Wo ist die Grenze zwischen Mut und Übermut?
R.M.: „Das ist eine schöne Frage. Angst ist die andere Hälfte des Mutes. Ich brauche nur Mut, weil ich Angst habe. Und wenn ich die beiden ins Gleichgewicht bringe, dann bin ich in der friedlichen Situation, um das zu meistern, was vor mir liegt. Übermut kommt meistens mit zu vielen Erfolgen. Die Lernphasen beim Bergsteigen passieren mit dem Scheitern.“
„T“: Scheitern ist aber nicht der Tod?
R.M.: „Scheitern heißt umdrehen. Das totale Scheitern ist der Tod. Heute im Rückblick, mit 66 Jahren, habe ich das Gefühl, dass die gescheiterten Expeditionen – ich habe immer das Leben nach Hause gerettet – meine stärksten Erfahrungen und Erlebnisse sind. Es kommt am Ende nicht auf den Rekord an, sondern es geht um die Erfahrung.“
„T“: Der Weg ist also das Ziel?
R.M.: „Dieser Ausspruch kommt irgendwo anders her. Das hat historische Hintergründe. Der Weg ist immer das Ziel. Ich gehe viel weiter. Die humane Erfahrung ist das Ziel. Das Erlebnis ist der Wert, den ich nach Hause bringe. Ob ich oben war oder nicht, spielt keine Rolle. Oben sein oder nicht, ist nur ein Anstrich nach außen, nicht nach innen. In meinen Büchern erzähle ich viel von den gescheiterten Expeditionen: Alleine an den 8.000ern bin ich 13 Mal gescheitert. Und ich bin heute stolz drauf.“
„T“: In der heutigen Leistungsgesellschaft ist das schwierig zu verkaufen.
R.M.: „Die Leute haben angefangen, die wesentliche Erfahrung zu verfälschen, um das zu haben, was das Publikum will. Aber wenn ich dem Publikum zuliebe klettere, ist man fremdbestimmt. Und jeder fremdbestimmte Bergsteiger ist abzulehnen.“
„T“: 1970 ist Ihr Bruder Günther beim Abstieg vom Nanga Parbat umgekommen. Sie irrten tagelang durch die Gegend und überlebten. Wie hat dieser Vorfall Ihre Bergsteigerkarriere verändert?
R.M.: „Diese Erfahrung hat mein Leben verändert. Das ist der erste Schnitt in meinem Leben, der klar gemacht hat: Was wir da tun, ist nicht vertretbar. Ich habe dann weitergemacht, weil ich rational verstanden habe: ich kann meinen Bruder nicht lebendig machen, wenn ich eine Karriere als Architekt anstrebe. Meine Leidenschaft waren die Berge.“
Yeti-Legende
„T“: Sie haben gesagt, Sie glauben nur etwas, das Sie nicht fassen können. Glauben Sie an den Yeti?
R.M.: „Ich weiß, dass die Legende vom Yeti auf den Tibet-Bären aufgebaut ist. Der Mensch hat seit Jahrtausenden mit diesem Ungeheuer Tibet-Bär oder Schneebär gelebt und in der Überlieferung zu einem Yeti – auch wenn er vor Ort nicht so heißt – hochstilisiert. Es gibt nichts Dümmeres als die Bergsteiger-Gemeinschaft, die nicht bereit ist, diese Geschichte nachzulesen. Es ärgert mich langsam. Im Grunde ist es so simpel. Weil die Antwort so klar und simpel ist, wollen die Leute sie nicht glauben. Weil sie weiterhin irgendwie an Humbug glauben. Ich glaube ja nicht, ich weiß. Es ist ein großer Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Glauben können Sie etwas, was im Jenseits passiert. Sie können an den lieben Gott glauben, aber nicht an den Yeti. Wenn ich an den Yeti glaube, bin ich ein absoluter Trottel. Entweder sage ich, der Yeti ist Humbug, Erfindung, Fantasie, aber diese Legenden-Figur geht zurück auf eine reale tierische Gattung, den Schnee- oder Tibet-Bären. Da gibt es keinen Zweifel. Auch spanische und japanische Wissenschaftler haben das nachgeprüft. Niemand ist aber bereit, die Geschichte zu lesen. Alle Leute wissen es besser. Die Verschwörungstheorien werden lieber geglaubt. Der Mensch ist so: Er glaubt lieber den schlimmsten Humbug, als die Realität. Ich schimpfe jetzt nicht mit Ihnen, aber mit der Allgemeinheit.“
„T“: Das heißt, die Bezeichnung Yeti ist falsch?
R.M.: „Der Name ist absolut falsch. Das ist eine Erfindung eines englischen Journalisten von vor 120 Jahren. Ich habe Dutzende von Namen für diesen Bär gefunden. Jeder Dialekt und jede Sprache hat einen anderen. Ich bin mir so sicher, weil ich im muslimischen Pakistan und 2.500 km weiter im Osten die gleichen Geschichten gefunden habe, nur mit verschiedenen Namen. Die Geschichte vom Yeti ist wahrscheinlich eine meiner wichtigsten Arbeiten (das Messner-Buch „Yeti – Legende und Wirklichkeit“ erschien 1998, d.Red.).“
„T“: Die Leute haben gesagt, der Messner halluziniert. Den Yeti gibt es gar nicht.
R.M.: „Das wäre für mich eine Beleidigung. Ich war immer ein sachlicher, genauer Mensch. Darum habe ich mich auch in der NangaParbat-Geschichte so gewehrt. Mir kann niemand vorwerfen, dass ich meinen Bruder umgebracht hätte. Aber mir hat man unterstellt, ich würde lügen. Momentan ist klar, dass die anderen gelogen haben, um irgendwelche Geschichten zu verkaufen und sich wichtig zu tun. Der Deutsche Alpenverein (DAV, achtgrößter Sportverband Deutschlands, größte Bergsportvereinigung der Welt, d. Red.) mit seinen 800.000 Mitgliedern hat behauptet, man würde meinen Bruder nicht auf der Diamir-Seite finden. Da kann ich nur sagen: das sind alle Schafsköpfe (die Überreste von Günther wurden im Sommer 2005 auf der Diamir-Seite gefunden, d. Red.). Die Folge war, dass der Alpenverein seinen Unter-Abteilungen empfohlen hat, mir keine Plattform mehr zu bieten. Und dann muss ich daran erinnern, dass 1924 – lange bevor die Nazis da waren –, da hat man alle Juden aus dem Alpenverein ausgeschlossen und ihnen die Hüttenzugänge verwehrt. Das war genau das Gleiche. Und wenn sie jetzt sagen, das kann man nicht vergleichen: Ich rede nicht über Mord, über Schäden, die man angerichtet hat, sondern über eine emotionale Ausgrenzung. Ausgrenzung war schon vor 100.000 Jahren die schlimmste Sprache. Wenn der deutsche Alpenverein heute sagt, wir konnten nicht anders, als die Juden auszugrenzen, dann sage ich: ‚aber 1924 noch nicht‘.“

 De Maart
De Maart

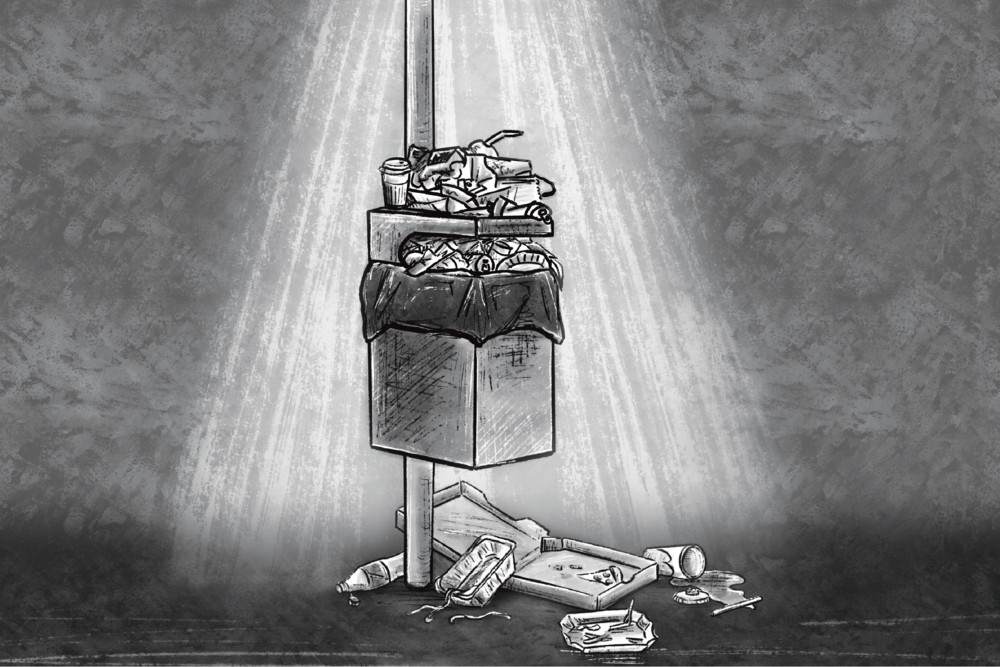





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können