Seit mehreren Monaten wird zwei Holocaust-Forschern in Warschau der Prozess gemacht. Heute Dienstag soll nun das Urteil gegen Barbara Engelking und Jan Grabowski fallen. Eine Verurteilung dürfte die Holocaust-Forschung in Polen für Jahre lahmlegen oder zumindest massiv beeinträchtigen. Doch genau darum geht es den Klägern im Umfeld der rechtskonservativen Kaczynski-Regierung.
Denn die paar beanstandeten Sätze und zwei Fußnoten in Engelkings und Grabowskis wissenschaftlichem Mammutwerk „Dalej jest noc“ (Und immer noch ist Nacht) von 2018 kratzen am polnischen Selbstbild der unschuldigen Opfer und Judenretter während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg.
Die beiden international renommierten Holocaust-Forscher haben zusammen mit anderen Autoren basierend auf jahrelangen Archivstudien Überlebensstrategien von aus Ghettos und deutschen KZs entflohenen Juden in neun ausgewählten Bezirken zwischen der Tatra im Südwesten des Landes und Ostpolen untersucht. Auf über 1.000 Seiten wird so ein gut dokumentiertes und sehr differenziertes Bild jenseits gängiger Schwarz-Weiß-Schablonen gezeichnet. Manche polnischen Judenretter – die dabei im Generalgouvernement nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer ganzen Familie riskiert hatten – wurden unter gewissen Umständen zwischen Schicksal und Zwang de facto zu Kollaborateuren der deutschen Besatzer, die Jagd auf die entlaufenen Juden machen.
Um einen solchen Fall könnte es sich beim Dorfschulzen von Malinowo bei Bielsk Podlaski handeln. Eduard Malinowski soll laut dem zweibändigen Mammutwerk zwar der Jüdin Estera Drogicka Ende 1942 zur Flucht nach Masuren verholfen haben, ein knappes Jahr später jedoch mitschuldig daran gewesen sein, dass über 20 Juden, die sich in den nahen Wäldern versteckt hatten, den deutschen Besatzungstruppen ausgeliefert und damit dem sicheren Tod durch die Deutschen überlassen wurden.
Historiker sollen sich öffentlich entschuldigen
Für diese Stelle in dem Forschungswerk hat die Nichte eines damaligen Ortsvorstehers, die heute über 80-jährige Filomena Leszczynska, gegen die Soziologin Engelking und den Historiker Grabowski Klage eingereicht. Bei Eduard Malinowski habe es sich um einen „Gerechten unter den Völkern“, einen Judenretter und nicht um einen Nazi-Kollaborateur gehandelt, wird in der Klageschrift begründet. Damit würde der Ruf ihrer Familie und auch der Polens geschädigt. Leszczynska verlangt dafür eine öffentliche Entschuldigung der beiden Holocaustforscher und umgerechnet knapp 23.000 Euro Entschädigung.
Unterstützt wird die Klägerin durch die der Regierungspartei PiS nahestehende Stiftung „Reduta. Festung des guten Namens – Liga gegen Verleumdung“. Die schon lange eng mit Jaroslaw Kaczynskis PiS verbundene Stiftung „Reduta“ ist vor allem für ihren Kampf gegen die falsche Bezeichnung „polnische KZs“ für die von den deutschen Besatzern ab 1940 auf polnischem Gebiet gebauten Konzentrations- und Vernichtungslager bekannt.
Doch die nun von „Reduta“ unterstützte Klage geht viel weiter, und schreibt sich dabei in die umstrittene PiS-Geschichtspolitik ein, die keinerlei wissenschaftliche Hinterfragung des Opfermythos der Polen zulassen will. Vor zwei Jahren musste PiS beim sogenannten „Holocaust-Gesetz“ nach massivem Druck aus Israel und den USA zurückkrebsen. Die Bezichtigung der Polen an einer wie auch immer gearteten Kollaboration mit den deutschen Besatzern zwischen 1939 und 1945 kann nun nicht mehr mit Gefängnis geahndet werden.
Obwohl sich die Klägerin nicht direkt auf das „Holocaust-Gesetz“ beruft, sondern nur von ihrem eigenen Ruf spricht, als ob dieser vererbt werden könnte, wäre eine auch nur teilweise Verurteilung Engelkings und Grabowskis ein Präzedenzfall.
Entsprechend groß ist der Protest gegen den seltsamen polnischen Gerichtsprozess. Yad Vashem spricht von „einer schwerwiegenden Attacke auf freie und offene Forschung“. „Längerfristig könnten solche Angriffe dazu führen, dass unabhängige Forschung über den Holocaust in Polen beendet wird“, befürchtet Jan Grabowski selbst. Auch der deutsche Historikerverband sieht ein „enormes Einschüchterungspotenzial“, wenn es überhaupt zu solchen Gerichtsverhandlungen komme.

 De Maart
De Maart

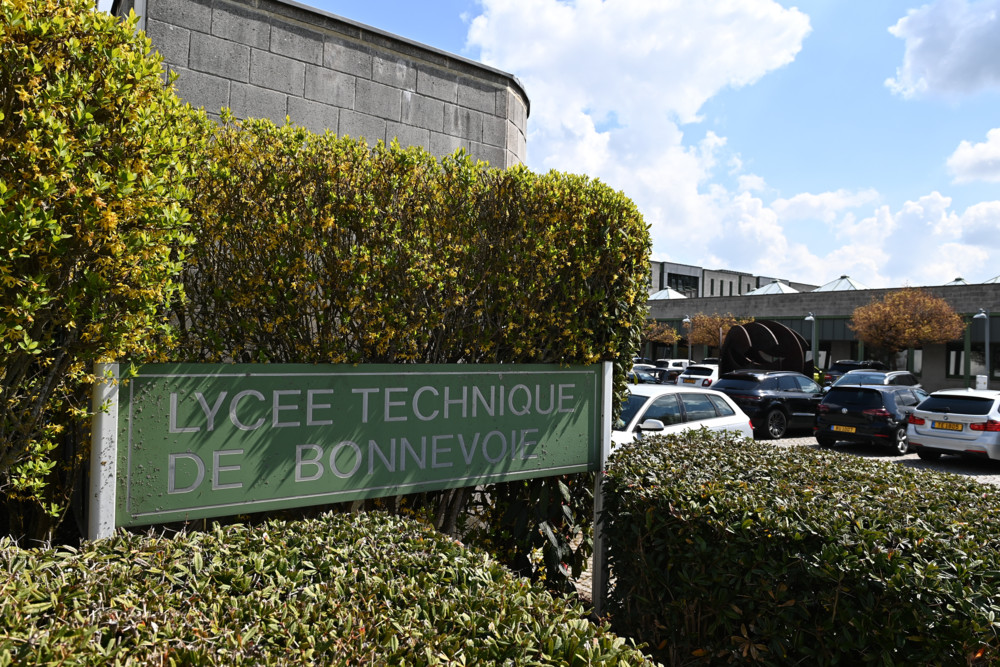





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können