So manches wurde in den letzten Jahren über Luxemburg und die Einstellung seiner Bevölkerung während der Okkupation geschrieben. Der Artuso-Bericht beleuchtete die Haltung der Verwaltungskommission in den ersten Monaten der Besatzung. Der Historiker Denis Scuto kommt regelmäßig auch in dieser Zeitung auf diese dunkle Periode des Landes zurück. Zuletzt hatte Mil Lorang mit seinem ausführlichen Beitrag im Tageblatt über die Beteiligung Luxemburger Soldaten an der Tötung von Juden in Osteuropa für Aufmerksamkeit gesorgt.
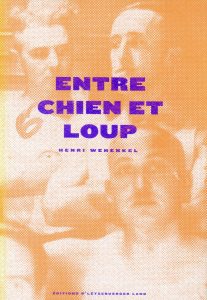 Henri Wehenkel ergänzt diese Arbeit mit einer Serie von Porträts von Menschen, die sich in jenen Jahren – wie die meisten Einwohner Luxemburgs auch – entscheiden mussten, wie sie sich gegenüber dem Besatzer verhalten sollten. Nicht alles war allen sofort klar, schreibt Wehenkel im Vorwort. Es gab Illusionen, Berechnungen, unterschiedliche Formen von Realismus, die an Kapitulation grenzten. Es gab verschiedene Identitäten. Man konnte gleichzeitig Resistenzler und Kollaborateur sein – Resistenzler in der Nacht, Kollaborateur am Tag. Wehenkel schildert in seinen Porträts diese Vielseitigkeit der einzelnen Protagonisten. Die Geschichte erzählen über Einzelschicksale macht erstere spannender und menschlicher. Geschichte wird greifbar. Für seine Arbeit durchforstete der Autor die Gerichtsakten, die im Rahmen der Säuberung nach dem Zweiten Weltkrieg angelegt worden waren.
Henri Wehenkel ergänzt diese Arbeit mit einer Serie von Porträts von Menschen, die sich in jenen Jahren – wie die meisten Einwohner Luxemburgs auch – entscheiden mussten, wie sie sich gegenüber dem Besatzer verhalten sollten. Nicht alles war allen sofort klar, schreibt Wehenkel im Vorwort. Es gab Illusionen, Berechnungen, unterschiedliche Formen von Realismus, die an Kapitulation grenzten. Es gab verschiedene Identitäten. Man konnte gleichzeitig Resistenzler und Kollaborateur sein – Resistenzler in der Nacht, Kollaborateur am Tag. Wehenkel schildert in seinen Porträts diese Vielseitigkeit der einzelnen Protagonisten. Die Geschichte erzählen über Einzelschicksale macht erstere spannender und menschlicher. Geschichte wird greifbar. Für seine Arbeit durchforstete der Autor die Gerichtsakten, die im Rahmen der Säuberung nach dem Zweiten Weltkrieg angelegt worden waren.
Tageblatt: Herr Wehenkel, wie haben Sie sich an das Thema herangewagt?
Henri Wehenkel: Das Prinzip war vom Allgemeinen weg zum ganz Konkreten, sodass in allen Geschichten anonyme Helden zu finden sind. Mit ihnen wird ein Aspekt der Wirklichkeit durch eine kleine Geschichte beleuchtet. So das Beispiel eines Arbeiters, der am frühen Morgen russischen Arbeitern (Zwangsarbeiter, die von den Nazis aus den besetzten Gebieten verschleppt worden waren, um in Luxemburg Eisenhütten zu arbeiten) begegnet und ihnen die Hand gibt. Er landet deswegen im KZ, weil er gegen die Rassenordnung verstoßen hatte.
Unter den 16 Porträts findet man wenige „richtige Bösewichte“.
Mich interessieren die extremen Figuren, etwa Sadisten, die andere gefoltert haben, nicht. Es kann natürlich ein falsches Bild geben, wenn man nur Personen aus der Mitte nimmt. Aber hier haben wir es mit Menschen zu tun, die eine gewisse Persönlichkeit hatten, solche aus dem öffentlichen Leben. Die aber heute fast niemand mehr kannte. Ein ganzer Aspekt der Wirklichkeit war damit unter den Tisch gefallen. Unterm Strich bleiben dann nur die Guten und die ganz Bösen.
Dabei stellte diese Mitte wohl die Mehrheit, oder?
Ja, und da stellt sich die Frage der Auswahl. Mich interessierte, welche Milieus betroffen waren, welche Ideen diese Leute hatten, ihre Herkunft. Das wird in der üblichen Geschichtsschreibung nicht geschildert. Die Helden haben keine Vergangenheit, die Verräter natürlich auch nicht, weil man ansonsten riskieren würde, dass sich einige in Luxemburg peinlich getroffen fühlen. Das gibt natürlich ein falsches Bild ab. Denn der Held ist ja nicht von Geburt aus Held, er fällt als solcher nicht vom Himmel. Er wird zum Helden. Der Verräter wird zum Verräter. Der Antisemit wird zum Antisemiten. Auch dieser ist es nicht von Geburt an.
Das heißt, das Umfeld, in dem sich ein Mensch bewegt, bestimmt auch sein Verhalten während dieser Jahre. Auch zufällige Bekanntschaften?
Ja, mit dem Risiko, dass einige irgendjemanden wiedererkennen könnten, was ihnen nicht gefallen wird. Meiner Ansicht nach wurde vieles in Luxemburg aus Rücksicht auf das kleine Milieu verfälscht. Von „Giele Männercher“ wird nicht geredet, auch wenn man wusste, dass es welche gab. Andere durfte man nicht fragen, was sich hinter ihrem Heldentum versteckte. Alles beruht ja auf Geschichten. Ich habe vermieden, eine Erzählung der organisierten Resistenz zu machen, der von den Kommunisten oder der Kirche. Denn auch da fragt man ja nur jene, die nach dem Krieg noch da waren, was sie denn im Krieg gemacht haben, wer dabei war. Viele andere treten dann nicht in Erscheinung.
Was erstaunlich ist: Die meisten Personen, die beispielsweise den Russen geholfen haben oder die Sabotageakte in den Werken organisierten, sind nicht bekannt. Viele haben sich nach dem Krieg mit derlei Taten gebrüstet, aber andere Namen kennt man nicht. Wie etwa Pierre Crelo. Ich habe herausgefunden, dass er später als Rentner in Colpach im Altersheim war. Er spielte aber eine große Rolle beim Streik für den Erhalt des Acht-Stunden-Arbeitstages. Er verbrachte einige Zeit im KZ Hinzert, hat aber dann weiter Widerstand geleistet.
In einer Ihrer Geschichten schreiben Sie von Streiks noch vor dem großen Auguststreik 1942 gegen die Zwangsrekrutierung. War es eine durchgehende Arbeitsniederlegung, nachdem die Besatzungsmacht den Arbeitstag von acht auf neun Stunden verlängert hatte?
Nein, die Arbeiter verrichteten nur acht Stunden. Statt um fünf kamen sie morgens um sechs. Sie taten so, als ob sie die neue Anordnung nicht verstanden hätten. Es gab daneben auch Versuche, den 12-Stunden-Tag einzuführen. Die Intensivierung der Arbeit ist ein interessanter Aspekt. So ging man mit der Stoppuhr in der Hand durch die Betriebe.
Sehen Sie in Ihrem Buch auch einen Bezug zu heutigen Zeiten?
Die Aktualität des Buches ist das darin zum Vorschein kommende Räsonieren in kollektiven Identitäten. Du bist Deutscher, ich bin Luxemburger, deshalb bin ich besser. Mich hat der kleinkarierte Nationalismus verwundert, der in Kollaboration übergeht.
Weil sich die Luxemburger als Teil einer größeren Identität gesehen haben …
Ja, der Nationalismus von „Siggy vu Lëtzebuerg“, der verlorenen Gebiete und des „Jang de Blannen“ ist ein frustrierter Nationalismus, der gerne unter dem Schutz einer Großmacht auf seinem Gebiet den völkischen Nationalismus betreiben will. Und der besteht darin, auszugrenzen.
Dadurch, dass Sie bei Ihren Porträts nicht klar herausarbeiten, ob der Betroffene ein „Guter“ oder ein „Schlechter“ ist die meisten bewegen sich in einer Grauzone , provozieren Sie den Leser dazu, sich der Frage zu stellen, wie er sich denn selbst unter ähnlichen Umständen verhalten hätte …
Das kann ich so nicht sagen. Aber bei diesen Personen gab es Voraussetzungen dafür, dass sie sich anschließend so verhielten. Das war der Fall beim „Schlimmsten“, dem Betriebsobmann Konrad Olinger, oder auch bei Ingenieur Julius Schaack auf Arbed-Belval. Schaack hat vor dem Krieg deutsche Arbeiter schikaniert, weil sie kein Luxemburgisch kannten, dann im Krieg wurde er ein Hurra-Deutscher. Bei allen gab es eine Vorgeschichte. Mindestens zwei oder drei reagieren nicht auf ihre Vergangenheit. Das ist der Fall bei Théo Kerg, der Kommunist war. Er wurde vom damaligen Staatsminister Joseph Bech sanktioniert, hatte in Luxemburg keinen sicheren Arbeitsplatz. Er geriet zuerst in Panik, hat aber dann versucht, da wieder rauszukommen. Der Ingenieur Pierre Schmit war ein ähnlicher Fall. Er ist einer derjenigen, die am meisten Juden gerettet haben.
Interessant ist tatsächlich, dass einige am Anfang mit den Nazis sympathisiert, dann aber eine Wendung vollzogen haben. Wie ist das zu erklären? Verblendung, Naivität?
Zu Beginn, am 10. Mai 1940, als die Deutschen kamen, waren sie alle erschrocken. Aber im Oktober desselben Jahres galt sowohl bei der Verwaltungskommission als auch bei der Arbed die Parole: „Wir müssen uns fügen, retten, was zu retten ist.“ Bei der Arbed kam am 25. Oktober eine Direktive der Generaldirektion, alle sollten sich den Anordnungen der VdB (Volksdeutsche Bewegung) fügen. Deshalb waren auch 99 Prozent in der DAF (Deutschen Arbeitsfront). Direktor Aloyse Meyer sagte, er habe die Anordnung nicht unterschrieben. Aber am 25. Oktober fand auf Belval eine Ausschusssitzung statt, bei der der Sekretär der Belvaler Schmelz, Pierre Schleimer, sie weitergab. Schleimer war kein Nazi. Das heißt, es kam von oben. Und da Resistenz zu leisten, das war schon eine große Entscheidung. Beim Generalstreik 1942 haben viele ihre VdB-Mitgliedskarte zurückgeschickt – ein Zeichen, dass sie welche hatten. Und viele stellten sich damals die Frage, warum sie 1940 so schnell nachgegeben hatten. Darüber lässt sich diskutieren. Aber es ist nicht so: Weil wir gute Luxemburger waren, waren wir gegen die Besatzung.
Bei den Gewerkschaften stellen sich ähnliche Fragen …
Die Gewerkschaften sind nicht verboten worden und sie sind nicht in den Untergrund gegangen. Auch sie haben gesagt, wir müssen retten, was wir können: das Gewerkschaftsheim, die Tageblatt-Belegschaft … Es wurde verhandelt und niemand wurde entlassen. Das Tageblatt war ja ohnehin schon inexistent, weil die Journalisten ins Ausland geflohen waren. Wenn die Gewerkschafter nicht zurückgekommen wären, wäre alles, auch die Kooperativen, beschlagnahmt worden. Es gelang den Gewerkschaften, die Kooperativen bis Juli 1942 zu erhalten. Als Gegenleistung mussten sie sich ruhig verhalten. Einzelne rutschten in die Kollaboration.
An der Basis entstand eine neue Gewerkschaft aus Basis-Ausschussleuten – etwa beim Generalstreik in der Ideal-Lederfabrik in Wiltz, wo sich drei Ausschussleute vor das Werk stellten. Sie sagten kein Wort, riefen nicht zum Streik auf. Die Arbeiter, die zur Arbeit kamen, gingen nach Hause, andere zogen durch die Straßen. Der Streik entstand auf einer gewerkschaftlichen Basis. Auch in Schifflingen, beim Streik gegen die Verlängerung der Arbeitszeiten.
Werden wir eine Fortsetzung lesen können?
Ich denke schon, dass ich weitermachen werde. Ist schon spannend.









Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können