Wieder eine Spionage-Geschichte? Nach Steffen Kopetzkys „Atom“ glaubt sich der Rezensent so richtig in der Schlapphut-Schleife gefangen, nachdem jahrelang kaum noch jemand an die Agentenzunft gedacht hatte und der eine oder andere fünf Jahre nach dem Ableben des Meisters John Le Carré nicht mehr an eine Renaissance des Fachs geglaubt hatte. Doch Rachel Kushners jüngstes, auf Deutsch erschienenes Buch eröffnet neue Türen zu ausgetreten geglaubten Pfaden. Und doch ist „See der Schöpfung“ etwas Besonderes.
Dabei schien es besser als „Flammenwerfer“ kaum noch zu gehen. Der vor zehn Jahren veröffentlichte zweite Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin hatte bereits einen solchen Drive, als würde man mit dem Motorrad bei einer Fahrt durch die Wüste aus der staubigen Kurve fliegen. So wie die Hauptperson Reno: „Es gab Dinge, etwa den Effekt des Windes auf die Wolken, die ich schlicht ignorieren musste, wenn ich mit hundertsechzig Stundenkilometern über den Highway fegte.“ Die junge Frau Anfang 20 liebt das Tempo und bleibt nicht lange an einem Ort. Sie hat Kunstgeschichte studiert und will Konzeptkünstlerin werden. „Land Art“ interpretiert sie so, indem sie ihre Reifenspuren filmt, die sie mit ihrer Maschine, einer „tiefkühleisfarbenen“ Moto Valera, hinterlässt.
Nach dem in mitreißender Prosa geschriebenen Roadmovie scheint bei „See der Schöpfung“ der Motor ins Stottern geraten zu sein. Die Ich-Erzählerin ist eine Agentin mit dem Decknamen Sadie Smith. Das lässt an die bekannte britische Autorin Zadie Smith denken, die tatsächlich ursprünglich „Sadie“ hieß, aber im Alter von 14 Jahren ihren Namen änderte sowie als Tochter eines englischen Vaters und einer jamaikanischen Mutter in einem Arbeiterviertel im Nordwesten Londons geboren wurde und dort aufwuchs. Rachel Kushner hingegen ist die Tochter zweier Forscher und Beatniks und wuchs die meiste Zeit in Kalifornien auf.
Spezialisiert auf Unterwanderung

Nach ihren bisher auf Deutsch erschienenen Büchern, dem literarischen Debüt „Telex aus Kuba“ (im Original bereits 2008 erschienen), „Flammenwerfer“, ihrem Buch „Ich bin ein Schicksal“ (2016) über eine in Kalifornien inhaftierte Frau als Kritik am Strafvollzug sowie dem Essayband „Harte Leute“ (2022) nun Buch über einen über eine toughe Agentin: Die 34-jährige Sadie Smith aus Kushners Roman, spezialisiert auf die Unterwanderung linker Gruppen mit dem Ziel, diese zu Gewalttaten zu animieren und damit zu diskreditieren, als weiblicher „Agent provocateur“ gewissermaßen, soll in geheimer Mission etwas über eine landwirtschaftliche Kommune in Südfrankreich herausfinden. Diese sogenannten Moulinarden werden verdächtigt, hinter Sabotageakten gegen ökologisch zweifelhafte Großprojekte in der Region zu stecken, etwa gegen den Bau riesiger Wasserbassins zum Zweck einer landwirtschaftlichen Monokultur, die der Region das Grundwasser entziehen.
Das verspricht den bekannten Drive. Wenn da nicht Bruno Lacombe wäre, der 80-jährige Anführer der Gruppe, die sich als Kommune aufs Land zurückgezogen hat. Der Anführer, der kryptische Mails an seine Anhänger verschickt, erinnert an den vor drei Jahren verstorbenen französischen Philosophen und Soziologen Bruno Latour, den Autor von „Das terrestrische Manifest“, im 2017 erschienenen Original „Où atterrir? Comment s’orienter en politique“, in dem er ein neues Verhältnis des Menschen zur Erde fordert. Um Verbundenheit mit der Erde geht es auch der Romanfigur Lacombe, der als eine Art Höhlenmensch lebt und den Frequenzen früherer Generationen nachspürt – und seinem familiären Trauma.
Seine Anhänger können sich den Botschaften des Sonderlings kaum entziehen, auch nicht die in die Kommune aus Pariser Mittelschichtensprösslingen infiltrierte Spionin. Doch eine Gefahr scheint von ihm nicht auszugehen. Vielmehr möchte Lacombe den Neandertaler rehabilitieren und befasst sich mit den Weisheiten polynesischer Kulturen wie etwa: „Ziele kamen bei den Seefahrern an, statt dass Seefahrer auf sie zusteuerten.“ Der menschliche Sündenfall fand demnach mit dem Übergang vom sanften, kollaborativen Neandertaler zum eigennützigen Homo sapiens statt. Er sei die Wurzel allen Übels. „Wir sind uns alle einig“, so Bruno Lacombe, „dass es der Homo sapiens war, der die Menschheit mit dem Kopf voran in die Landwirtschaft, das Geldwesen und die Industrie trieb. Aber das Rätsel, was mit dem Neandertaler und seinem bescheideneren Leben passiert ist, bleibt ungelöst.“
Ziele kamen bei den Seefahrern an, statt dass Seefahrer auf sie zusteuerten
Interessant ist dabei das Verhältnis der beiden Protagonisten Lacombe und Smith, der Mann des Worts und die Frau der Tat. Der Philosoph aus der Höhle wirkt eloquent und gelehrt, die Agentin ordinär, schnoddrig und bisweilen sogar zynisch. Anfangs blickt die frühere FBI-Agentin verächtlich auf die Kommune und auf die Provinz. Einen moralischen Kompass scheint sie nicht zu besitzen, ihr Weltbild ist nihilistisch, ihre Vergangenheit unklar: „Es gibt keine Gerechtigkeit. Schlechte Menschen werden geehrt, gute bestraft. Auch das Gegenteil stimmt. Gute Menschen werden geehrt, schlechte bestraft, und manche werden das Gnade nennen oder die Hand Gottes anstatt Glück. Aber im tiefsten Inneren, (…) wissen alle, dass die Welt gesetzlos ist, chaotisch und willkürlich.“ Mehr und mehr kommen in ihr Zweifel auf, sinkt ihre Abgebrühtheit. Und Bruno ist davon überzeugt, dass die Menschheit in einem „funkelnden, führerlosen Wagen“ auf ihr Aussterben zurast.
Prozess gegen die „Acht aus Tarnac“
Die Idee zu dem Roman ist Kushner nach eigenen Aussagen bereits 2008 gekommen, als sie von dem Fall Tarnac hörte, einer Gemeinde in der Corrèze, in der einige Sabotageakte an Oberleitungen verübt worden waren. Die Autorin kennt Frankreich und die Region gut. Bei Recherchen stellte sie fest, dass die Gruppen von Tarnac vom Staat und von Lobbyisten unterwandert worden waren. Im März 2008 begann der Prozess gegen die „Acht aus Tarnac“, der das kleine Dorf über die Landesgrenzen hinaus bekannt machte.
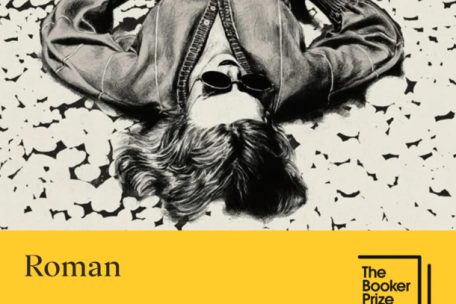
Etwa zehn Jahre dauerte das Verfahren gegen die acht Beschuldigten, sieben von ihnen wurden vollumfänglich freigesprochen. Weder habe es sich um eine kriminelle Gruppe gehandelt, noch hätten genügend Beweise vorgelegen, dass sie 2008 eine TGV-Strecke sabotiert hätten, verkündete das Pariser Gericht. Nur einer der Beschuldigten wurde wegen Hehlerei zu vier Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Die Bewohner der Kommune waren wegen der Aussagen des britischen Polizeispitzels Mark Kennedy in die Fänge von Geheimdienst und Antiterrorpolizei geraten.
Zu jener Zeit hatte die Flugschrift „Der kommende Aufstand“ kursiert. Zum Schluss gab selbst die Staatsanwaltschaft zu, dass es keine terroristische Gruppe aus Tarnac gab. Es hatte sich um eine Konstruktion der Polizei gehandelt. Zu den Inspirationsquellen für Kushners Roman gehört eben jener Mark Kennedy, der die Umweltbewegung als „Agent provocateur“ sieben Jahre lang infiltriert hat. Die Schriftstellerin betonte in einem Interview, dass er sich in einem „Paralleluniversum“ befunden habe.
Rachel Kushner: „See der Schöpfung“. Roman. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell. Rowohlt Verlag. Hamburg 2025. 480 Seiten.

 De Maart
De Maart









Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können