Am Donnerstag beginnen die „Assises culturelles“, wo das Kulturentwicklungsprogramm für Luxemburg vorgestellt wird. Doch wie sieht es eigentlich bei der Beziehung zwischen Kultur und Schule aus?
Keiner kann sagen, dass in der Schule keine Kultur vermittelt werde. Ist die Schule ein Ort der Kulturvermittlung? Und vor allem, ist sie ausreichend? Wir sprachen mit verschiedenen Akteuren, die im Alltag mit dem Thema konfrontiert sind.
Luc Belling ist Leiter der Abteilung für Bildungsinitiativen und Programmkoordination beim Script („Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques“) und in dieser Funktion verantwortlich für Kulturprojekte, die das Bildungsministerium in Schulen unterstützt.
Tageblatt: Herr Belling, sehen Sie im Bereich „Kultur und Schule“ Verbesserungsbedarf?
Luc Belling: Schwer zu sagen, da wir im Script ja versuchen, auf sämtlichen Ebenen Initiativen zu ergreifen und das auch tun. Wenn etwas zu verbessern wäre, müsste man den Lehrern vielleicht noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellen, damit sie kulturelle Projekte auch umsetzen können. Dabei stellt sich vor allem die Frage, wie weit man kulturelle Aktivitäten in den Lehrplan integrieren kann. Die Frage, inwieweit es Pflicht sein soll, zum Beispiel noch mehr Literatur zu machen, oder ganz allgemein mehr kulturelle Projekte anzubieten, ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, die größte Herausforderung ist es, in einen gut gefüllten Stundenplan auch noch das transversale Thema Kultur zu integrieren. Das versuchen wir, über Initiativen zu erleichtern, aber das geschieht nicht von heute auf morgen.
Was meinen Sie mit Ressourcen? Mehr Geld?
Ich meine damit nicht nur mehr finanzielle Mittel, sondern vor allem die Möglichkeiten, Projekte anbieten zu können. „Kulturama“ zum Beispiel ist ein Projekt, in dem wir Künstler für gemeinsame Projekte in den Schulen zur Verfügung stellen. Projekte, die wir anbieten, gibt es sehr viele, sowohl für Grundschulen als auch für die Gymnasien. Zum Beispiel „Be a Hearo“ mit der Rockhal, „Hip-hop-Marathon“ mit den Rotondes, Theater-Ateliers mit der Compagnie Grand Boube unter anderen. Es ist die Aufgabe des Script, den interessierten Schulen all diese Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ob sie dann die Projekt alleine machen können, ist eine andere Frage. Kunstlehrer mal ausgenommen, kann man nicht von allen Lehrern verlangen, dass sie Kompetenzen in Kunst, Musik usw. besitzen, die man manchmal bräuchte, um Projekte gut mit der Klasse umzusetzen.
Wenn Sie von mehr Ressourcen reden, bedeutet das im Umkehrschluss, dass Sie schon mal Projektvorschläge von Lehrern ablehnen mussten, weil die nötigen Finanzmittel fehlen?
Nein, das nicht. Man kann nicht sagen, dass wir – angesichts der Summen, die wir jedes Jahr in Konventionen und Projekte stecken – nicht genug in die Kultur investieren. Das sind schon große Summen. Alle Konventionen, Projekte und auch die Stunden, für welche die Lehrer freigestellt werden, zusammengerechnet, kommt man auf über eine Million Euro. Natürlich, wenn man das nun hochrechnet und jedem die gleichen Möglichkeiten anbieten wollte, würde es anfangen, schwierig zu werden. Man muss Wege finden, wie man dauerhaft mehr kulturelle Inhalte in das Schulprogramm integrieren kann.
Also eher ein Zeitproblem.
Genau. Der Lehrplan ist vollgepackt und das Problem ist, die Zeit zu finden, um noch zusätzliche kulturelle Themen einzubauen.
Haben Sie im Hinblick auf die „Assises culturelles“ konkrete Erwartungen?
Wir als Schulministerium weniger. Wir sind natürlich schon gespannt auf die Aussagen, die dort gemacht werden. Wir gehen eher entspannt in die „Assises“, wir haben ja schon einige Projekte mit dem Kulturministerium zusammen ausgearbeitet. Wir sind für die nächste Zeit gut aufgestellt mit vielen Projekten und Initiativen. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt kommen sollte und uns überraschen würde.
Im Stundenplan gibt es ein Ungleichgewicht, was die kulturellen Themen angeht. Literatur zum Beispiel wird relativ viel behandelt, andere kulturelle Aktivitäten wie Musik schon weniger.
Das stimmt, Musik ist ein Spezialisierungsfach, was natürlich auf der Sektion F behandelt wird, es gibt natürlich die Möglichkeit, über die Optionsfächer kulturelle Themen anzubieten, sei es in den Kunst- oder Theatersektionen, aber da trifft man dann eben nur die interessierten Schüler. Nehmen wir das Beispiel Theater, ein Bereich, der ja von seinem Inhalt her auch gut in einen Regelunterricht passen würde, aber da muss man schon einen engagierten Lehrer dafür finden, der sich an das Thema heranwagt.
Gibt es Überlegungen, mittel- oder langfristig das Lehrprogramm so zu ändern, dass Kultur noch mehr in Betracht gezogen wird?
Ich glaube schon, dass verschiedene strukturelle Änderungen gemacht worden sind, was man aber erst auf den zweiten Blick sieht. Sehen Sie sich zum Beispiel die Reform der Schulautonomie an: Man hat den Sekundarschulen mehr Freiraum gegeben und eine Schule, die für sich entscheidet, sie wolle sich kulturell noch besser aufstellen, kann das tun. Ein gutes Beispiel ist das „Lycée Ermesinde“, wo sehr viel in dem Bereich gearbeitet wird. Und es ist ja nicht so, dass das Ministerium sagt, so, jetzt wird dies und das getan. Es geschieht ja immer in Zusammenarbeit mit den Programmkommissionen und mit denen entscheiden wir dann zusammen, falls es einen Bedarf gibt, noch mehr kulturelle Themen zu integrieren. Aber wenn man etwas hinzufügt, muss man auf anderer Seite etwas wegnehmen, und spätestens an dem Punkt fangen die Diskussionen dann an.
Wie viele Anträge von Lehrern erhalten Sie pro Jahr für kulturelle Projekte?
Es dürften so um die 50-60 größere Projekte sein, die wir unterstützten, zum Beispiel Hip-Hop-Marathon, Projekt ID, Aber viele Projekte werden von den Schulen selbst bezahlt, es handelt sich also um Projekte, von denen wir nichts mitbekommen.
Kultur als sozialer Kitt
Jeanne Glesener war Berichterstatterin bei den „Assises culturelles“ 2016 für den Teil „Ecole – un lieu de transmission culturelle“. Im Zusammenhang Kultur und Schule machte sie folgende Überlegungen. In ihrer Eigenschaft als Literaturwissenschaftlerin an der Universität habe sie einmal eine Ringvorlesung organisiert über die Kulturgeschichte Luxemburgs, die ziemlich gut von den Student aufgenommen worden sei. Eine Reaktion der Studenten war, dass sie es „immens interessant“ fanden, überhaupt etwas über die Kulturgeschichte Luxemburgs erfahren zu haben.
„Sie sagten mir, es sei das erste Mal gewesen, dass sie mehr über den kulturellen Raum erfuhren, in dem sie lebten, was im Sekundarunterricht nie geschehen sei.“ Wenn man von Kultur rede, werde oft gesagt, sie sei wichtig für die soziale Integration und den sozialen Zusammenhalt, fuhr sie fort. „Ich verstehe nicht, was das bedeuten soll, wenn wir nicht den Schritt gehen, das Wissen über das, was Luxemburg auch kulturell darstellt, zu vermitteln. Und Kultur ist ja nicht nur die hohe Literatur oder abstrakte Kunst. Es sind auch unsere Alltagsgewohnheiten, wie wir uns kleiden, was wir essen – das geht schon sehr weit. Wie das alles entstanden ist, in einem kulturell vielfältigen Land wie Luxemburg, ist eine interessante Frage. Und das ist ja kein Phänomen der Globalisierung, das fing schon früher, während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, an, vielleicht noch früher, da Luxemburg immer eine Gegend war, wo viel Austausch stattfand.“
Allerdings gebe es eine positive Nachwirkung der Vorlesungen. Das Bildungsministerium habe beschlossen, ein E-Book, basierend auf den Vorlesungen, zu veröffentlichen, das auch im Sekundarunterricht eingesetzt werden soll.
„Es ist ein Gesellschaftsproblem“
Camille Kerger ist Musiker und ist als ehemaliger Leiter des „Institut européen de chant choral, Luxembourg“ gut mit dem Problem Kultur (in seinem spezifischen Fall Musik) in der Schule vertraut. Er ist zudem Mitglied des „Forum Culture“, das Anfang des Jahres die Kulturpolitik der Regierung unter die Lupe nahm.
Tageblatt: Herr Kerger, gibt es ausreichend Kulturvermittlung in den Schulen?
Camille Kerger: Ganz klar nein. Mir fällt da ganz spontan die Rede von Nico Helminger ein, die er anlässlich der „Prix Servais“-Verleihung am vorigen Sonntag hielt und in der er kritisierte, dass in den Schulen nicht genügend luxemburgische Autoren berücksichtigt würden. Als Leiter des IECC war ich oft mit der Thematik befasst, wir haben oft Fachleute in die Schulen entsandt, die dort Kurse gaben. Aber das lief nur so lange gut, wie wir in den Schulen präsent waren. Ich erinnere mich an ein ganz präzises Beispiel, wo nach vier, fünf Jahren eigentlich die Lehrer dazu in der Lage hätten sein sollten, das gleiche Wissen zu vermitteln. Nichts geschah. Es bestand kein Interesse vonseiten der Lehrer.
Glauben Sie, es hat vielleicht etwas mit der Ausbildung der Lehrer zu tun?
Es fängt schon viel früher an. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem. Wenn die Kultur nicht breit in der Gesellschaft verankert ist, dann kann man auch kein Interesse der Lehrer erwarten. Und man darf nicht vergessen, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Der Durchschnittsbürger verwendet immer weniger Zeit für immer mehr Dinge. Durch das Internet sind wir gewohnt, Wissen schnell zu bekommen. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Aufmerksamskeitsspanne des Menschen stark gesunken ist. Und das wirkt sich negativ auf das Interesse an der Musik und der Kunst im Allgemeinen aus.

 De Maart
De Maart








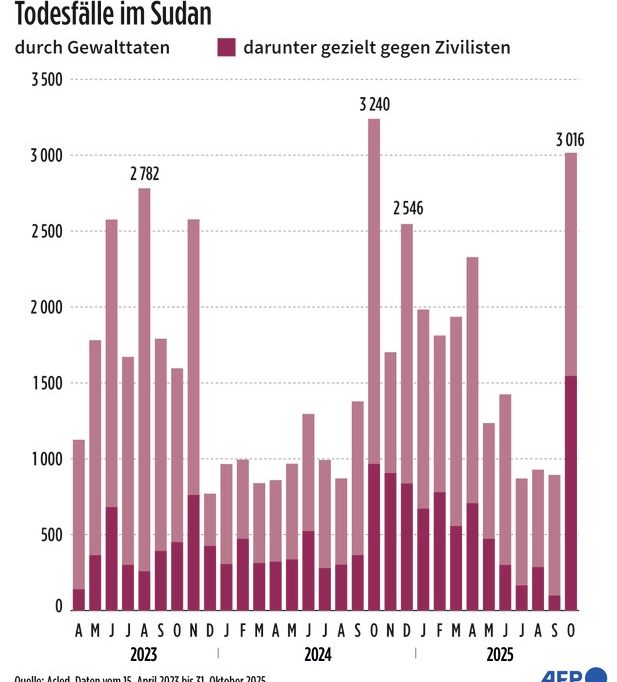
Was ist eigentlich Kultur? Wer bestimmt das? Wo ist der Unterschied zwischen Bildung und Kultur ? Kultur ist ein dehnbarer Begriff, von dem man nicht weiss wo er anfängt und wo er aufhört. Ein inflationärer Begriff der sehr strapaziert wird und der für so manches herhalten muss. Selbsternannte Kulturpäpste und solche die es sein wollen gibt es zuhauf.