Ein Raubkunstgemälde, das der NS-Kunsthändler Hildebrand Gurlitt für Adolf Hitlers „Führermuseum“ kaufte, ist nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ den Nachfahren eines NS-Kasernenwarts zugesprochen worden. Das Amtsgericht München entschied demnach im Mai, dass das Bild in den Besitz der Münchner Familie zurückgeht. Die mutmaßliche Eigentümerin war in der NS-Zeit als Jüdin deportiert und ermordet worden. Laut Bundesamt für offene Vermögensfragen gebe es keine Erben mehr, die Ansprüche geltend machen, berichtet die „SZ“ (Samstag). Das Amtsgericht war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.
Gurlitt hatte das Gemälde „Bergpredigt“ des flämischen Barockmalers Frans Francken im besetzten Frankreich erworben und 1943 an Hitler für dessen in Linz geplantes Museum verkauft. Seit April 1945 galt das Gemälde als verschollen. Zusammen mit rund 650 anderen Werken verschwand es, als gegen Ende des Zweiten Weltkriegs der sogenannte Führerbau am Münchner Königsplatz geplündert wurde.
Kein klarer Eigentümer
Dabei gelangte es dem Bericht zufolge unter ungeklärten Umständen in den Besitz eines Kasernenwarts und dessen Erbinnen. Ein klarer Eigentümer habe sich jetzt nicht mehr ausmachen lassen – und der Staat habe auch keinen Anspruch geltend gemacht, denn das Bild soll rechtmäßig nicht Hitler, sondern der Jüdin Valerie Honig gehört haben, also aus Privatbesitz stammen.
Im November 2008 war die „Bergpredigt“ im Schätzwert von rund 100 000 Euro in der BR-Fernsehsendung „Kunst&Krempel“ gezeigt und von einem Zuschauer als Raubkunst identifiziert worden. Daraufhin ermittelte das Landeskriminalamt Bayern. Das Gemälde soll von demselben Händler stammen, bei dem Gurlitt auch viele der umstrittenen Werke erstand, die sich später bei seinem Sohn Cornelius fanden. Cornelius Gurlitt, der Anfang Mai in München starb, stand monatelang im Zentrum einer Nazi-Raubkunst-Debatte um seine Sammlung.

 De Maart
De Maart




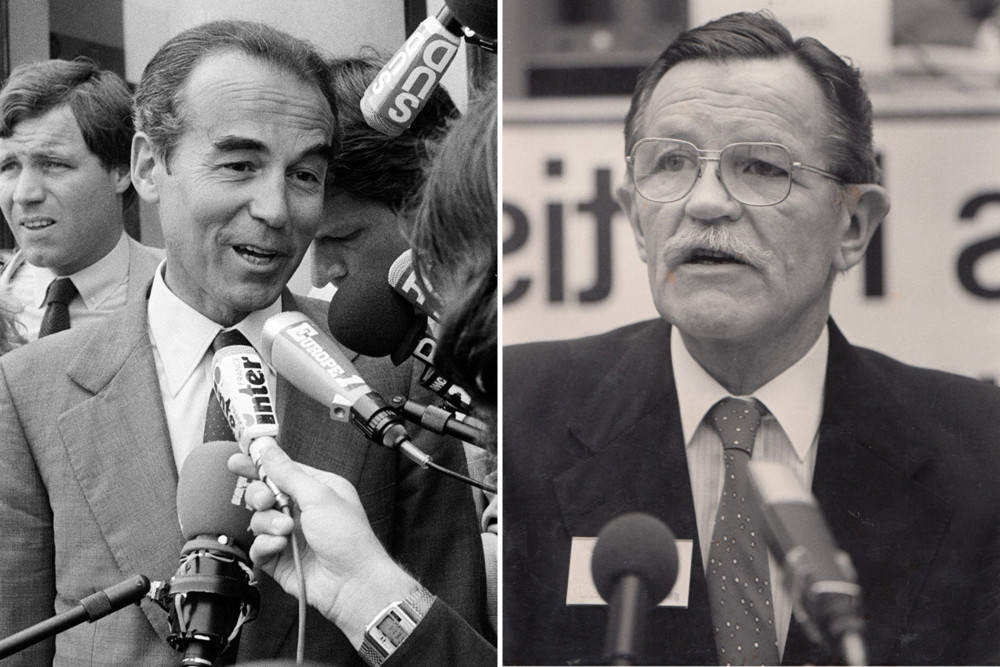




Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können