Rorschachtest
 Ein neues Album des genialen Diabolo Swing Orchestra muss sich vor allem an einem messen lassen: an seinen drei Vorgänger n. Ein anderes Maß kann hier gar nicht angewendet werden – das Oktett aus Schweden setzt seine ganz eigenen Maßstäbe. Oder anders gesagt: Vom DSO erwartet man nichts anderes als ein gottverdammtes musikalisches Meisterwerk.
Ein neues Album des genialen Diabolo Swing Orchestra muss sich vor allem an einem messen lassen: an seinen drei Vorgänger n. Ein anderes Maß kann hier gar nicht angewendet werden – das Oktett aus Schweden setzt seine ganz eigenen Maßstäbe. Oder anders gesagt: Vom DSO erwartet man nichts anderes als ein gottverdammtes musikalisches Meisterwerk.
Genau das macht aus der Bewertung von Pacifisticuffs eine so schwere und undankbare Aufgabe … Das DSO – anfangs noch als Geheimtipp gehandelt – hat sich in den letzten Jahren mit seinem außergewöhnlichen Stilmix einen Namen gemacht und eine Fanschar erarbeitet. Die Band verbindet ohne Skrupel Genres von Jazz über Metal, Tango, Disko und Swing bis Blue Grass und schöpft bei ihrem Schaffen aus der vollen Palette des Orchestergrabens und geht noch den entscheidenden Schritt darüber hinaus. E-Gitarren gehören ebenso zum Instrumentarium wie das Didgeridoo und das Banjo.
Die einzige Konstante, die es in der Musik des DSO zu geben scheint, ist das (fast immer) hohe Tempo, das ebenso wild ist wie der Mix, der dem DSO das Prädikat Avantgarde-Metal eingebracht hat. „Pacifisticuffs“ ist das vierte Studioalbum der Schweden. Neben den acht Bandmitgliedern wirkten elf weitere Musiker an der Scheibe mit. Ursprünglich sollte diese schon im letzten Jahr erscheinen, doch technische Probleme beim Mischen des Albums verzögerten die Veröffentlichung.
Einstieg in neue Ära
„Pacifisticuffs“ ist überdies für das DSO der Einstieg in eine neue Ära, nachdem die stimmgewaltige Sängerin Annlouice Loegdlund aus der Band ausgeschieden und durch die nicht weniger begabte Kristin Evegård ersetzt worden war. Wie auch die vorherigen Alben ist „Pacifisticuffs“ ein musikalischer Rorschachtest, bei dem man glaubt, in jedem Lied etwas anderes zu erkennen.
Zu den Highlights gehören sicher „The Age Of Vulture Culture“ (Gypsy-Folk), „Jigsaw Hustle“ (Disko) und „Superhero Jagganath“ (Metal, Big Band, Ravels Boléro?). „Pacifisticuffs“ ist ohne Zweifel sehr, sehr gut. Ob die CD in der Anlage allerdings genauso schnell abnutzen wird wie die älteren Alben, ist fraglich. gr
Anspieltipps: The Age Of Vulture Culture, Jigsaw Hustle, Superhero Jagganath
Schön ist anders
 Nachdem sich Glassjaw in den letzten Jahren in unregelmäßigen Abständen zurückgemeldet haben, sind sie nun mit einem kurzen, brutalen Album zurück, das wie ein Schlag ins Gesicht wirkt – und mit seinen apokalyptischen Visionen jede Hoffnung auf gute Neujahrsvorsätze potenzieller Planetenzerstörer wie Donald Trump, Kim Jong-un und Co. in Grund und Boden stampft.
Nachdem sich Glassjaw in den letzten Jahren in unregelmäßigen Abständen zurückgemeldet haben, sind sie nun mit einem kurzen, brutalen Album zurück, das wie ein Schlag ins Gesicht wirkt – und mit seinen apokalyptischen Visionen jede Hoffnung auf gute Neujahrsvorsätze potenzieller Planetenzerstörer wie Donald Trump, Kim Jong-un und Co. in Grund und Boden stampft.
Wer sich die Songtitel von Material Control durchliest („new white extremity“, „pompeii“, „bastille day“, „cut and run“) und die Band ein klein bisschen kennt, weiß sofort, dass einen hier eine gute halbe Stunde Krach und Zerstörung erwartet. Glassjaw, die mittlerweile mit Gitarrist Justin Beck (der hier auch Bass spielt) und Sänger Daryl Palumbo zum Studio-Duo geschrumpft sind, werden auf der Platte von Schlagzeuger Billy Rymer, der bei den mittlerweile dahingeschiedenen The Dillinger Escape Plan für komplexe Drum-Patterns verantwortlich war, unterstützt. Und auch wenn hier die Rhythmus-Sektion etwas simpler daherkommt, hört man deutlich Mathrock-Elemente in Songs wie dem chaotischen „golgotha“ heraus.
Im Gegensatz zu Sänger Daryl Palumbos Performance beim tanzbaren Nebenprojekt Head Automatica keift und brüllt der Mann hier mehr, als dass er Wert auf saubere Töne legen würde: Im Wechselspiel zwischen Geschrei und Melodie siegt auf „Glass Material“ die Dissonanz deutlich. Im besten Fall klingt dies (auf „shira“) wie eine kompromisslose, hässlichere Version der Deftones. Im Laufe fast aller Songs dieser unangenehm tollen Platte fräst sich der Bass bis ins Mark, die Gitarren basteln im Hintergrund sonore Landschaften des Verfalls, die der Gesang stoisch schreiend oder melodisch mitleidsvoll kommentiert – falls man mit dem exemplarischen Openerduo „new white extremity“ und „shira“ nichts anfangen kann, sollte man die Finger von der Platte lassen. Kritisieren könnte man lediglich die große Homogenität – das ruhige und schöne, nichtsdestotrotz bedrohliche „strange hours“ und das perkussive, atmosphärische „bastille day“ in der Mitte der Patte machen definitiv Lust auf mehr –, diese schöne Atempause ist hier aber nur kurzer Waffenstillstand, bevor man sich wieder mit zwiespältiger Lust in den apokalyptischen, kathartischen Moshpit dieser Platte stürzt. js
Anspieltipps: shira, strange hours, new white extremity
Funky Shit
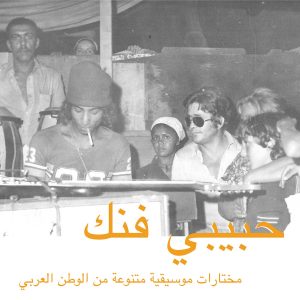 Sprachbarrieren sind da, um überwunden zu werden. Musik stellt dafür ein patentes Mittel dar. Nun möchte ich mir auf keinen Fall vorstellen, wie es wäre, als Tourist oder gar als Geflüchteter in Luxemburg anzukommen und sofort mit Käpt’n Ändä konfrontiert zu werden. Damit vergrault man wohl eher seine Gäste. Zumindest besteht jetzt für etwas fremdenscheue Luxemburger die Möglichkeit, sich der Musik einer bestimmten Bevölkerunggruppe anzunähern, die sie scheinbar ab und an fürchtet.
Sprachbarrieren sind da, um überwunden zu werden. Musik stellt dafür ein patentes Mittel dar. Nun möchte ich mir auf keinen Fall vorstellen, wie es wäre, als Tourist oder gar als Geflüchteter in Luxemburg anzukommen und sofort mit Käpt’n Ändä konfrontiert zu werden. Damit vergrault man wohl eher seine Gäste. Zumindest besteht jetzt für etwas fremdenscheue Luxemburger die Möglichkeit, sich der Musik einer bestimmten Bevölkerunggruppe anzunähern, die sie scheinbar ab und an fürchtet.
as Kollektiv Habibi Funk hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, friedlich gegen die stereotype Wahrnehmung von arabischer Musik anzukämpfen und stellt Compilations mit Stücken aus dem arabischen Raum zusammen, die einen funkigen Sound haben, ohne dass das Genre jedoch je wirklich dort existiert hätte. Es entsteht quasi ein neues kleines Mikro-Genre.
Auf ihrer neuen Compilation Habibi Funk 007: An Eclectic Selection of Music From the Arab World kommen keineswegs nur Tracks zusammen, die einen westlichen Einfluss erahnen lassen, sondern auch kreative Spielarten des arabischen Zouk, algerischen Coladera oder auch libanesischen AOR. Hier wurde äußerst Hörenswertes von einem Team von Musikliebhabern zusammengestellt, die es verstehen, alte Schätze auszugraben. Kopf der ganzen Sache ist der DJ und Plattensammler Jannis Stürtz, der das Label Jakarta Records leitet. Während des Reisens stieß er erstmals in Marokko auf der Suche nach Secondhand-Platten auf ungeahnt spannende Songs.
Auf der neuen Platte findet man unter anderem Stücke, die während Kriegszeiten komponiert wurden, andere im Exil. Sie stammen aus ganz unterschiedlichen Orten und weisen nicht nur in Bezug auf ihre Herkunft eine große Vielfalt auf. Wer sich nicht vorstellen kann, wie sich Beethovens „Pour Elise“ mit funkigen Gitarrensiffs und arabischem Gesang anhört, der sollte reinhören. Ebenfalls bietet „Jalil Bennis et les Golden Hands“ einen fantastischen Soundtrack, um morgens plötzlich gut gelaunt zur Arbeit zu tanzen. Und mit Hamid El Shaeri im Hintergrund kann man kommenden Sommer dem Sonnenuntergang entgegenlächeln. Eine exzellente Chance genutzt, um (auf bandcamp.com) in ein Stück ungeschriebene Musikgeschichte hineinhören. ans
Anspieltipps: Mirza, Sah, Bossa
„Who Built the Moon?“
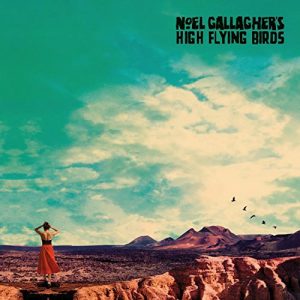 Keine Frage: Das neueste Werk von Noel Gallagher’s the High Flying Birds ist ein mutiges, experimentelles Album, das viele Oasis-Hardcore-Fans aufgrund mancher Techno-Beats, Psychedelic-Rock- sowie 70er-Glamrock-Passagen vehement ablehnen.
Keine Frage: Das neueste Werk von Noel Gallagher’s the High Flying Birds ist ein mutiges, experimentelles Album, das viele Oasis-Hardcore-Fans aufgrund mancher Techno-Beats, Psychedelic-Rock- sowie 70er-Glamrock-Passagen vehement ablehnen.
Darauf angesprochen gab der ältere der beiden Gallagher-Brüder kürzlich im Zeit-Magazin Folgendes zu Protokoll: „Jede Wette, dass die Großeltern dieser Parka-Affen damals Bob Dylan beschimpften, als er zur elektrischen Gitarre griff, und sich über die langen Haare der Beatles aufregten und über Yoko Ono, die böse Japanerin.“ Gut gekontert!
Sein Mut zum Experiment in allen Ehren, doch leider übertreibt es Noel Gallagher ein bisschen mit dem Übereinanderlegen von Soundschichten, sodass das Endresultat zwar groovt, doch an manchen Stellen auch breiig klingt. Außerdem hat er seine recht dünne Stimme mit so viel Hall unterlegt, dass sie sich, fast zur Unkenntlichkeit verfremdet, in endlosen Sphären verliert und auf massive Unterstützung seiner Background-Sängerinnen angewiesen ist.
Bryan Markus Bertrand
Nach dem Semi-Instrumental „Fort Knox“, das mit fetten Drums, strammer Rhythmus-Gitarre und dem Mantra „Keep on Holding out“ Lust auf mehr macht, muss man erst einmal „Holy Mountain“ überstehen. Was zum Teufel ist das denn? Eine Art Kreuzung aus „Let’s Stick Together“, „Gib Gas, ich will Spaß“ und „Ça plane pour moi“?! Es folgen zwei weitere treibende Stücke: „Keep on Reaching“ reißt einen mit schwungvollen Bläsersätzen mit, „It’s a Beautiful World“ mit einer originellen Gitarren-Figur, die allerdings ein bisschen von The Cults „She Sells Sanctuary“ abgekupfert ist.
Dann wird man der Stampfrhythmen etwas müde und ist gegen Mitte des Albums dankbar für das vom schleppenden Groove her an John Lennons „Come Together“ erinnernde „Be Careful What You Wish for“, in dem der 50-Jährige endlich den Mut hat, seine Stimme ohne Hall nach vorne zu mischen. Auch das abschließende melodiöse Epos „The Man Who Built the Moon“ sowie der bei einer Radio-Session mitgeschnittene Bonus-Track „Dead in the Water“ sind Gallagher at his best. Gil Max
Anspieltipps: Keep on Reaching, Be Careful What You Wish For, The Man Who Built the Moon

 De Maart
De Maart



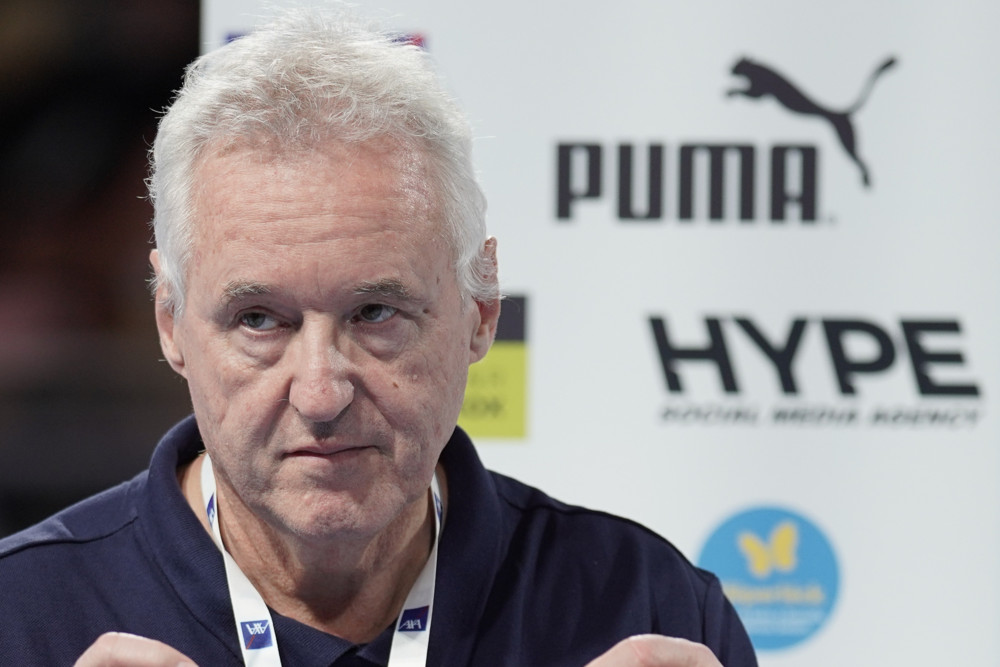



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können