Über 25 Jahre hat es gedauert, bis Terry Gilliams Verfilmung des weltbekannten Don Quichotte das Licht der Welt (erstmals als Abschlussfilm in Cannes) erblicken konnte. Vor ihm hatte sich bereits Orson Welles die Zähne an dieser Figur ausgebissen. Nun hat Gilliam das Werk von Cervantes, das als allererster Roman der Weltgeschichte gilt, wie Quichotte seine Windmühlen bezwungen. Und dabei natürlich so einige Federn gelassen. Trotzdem oder gerade deswegen ist „The Man Who Killed Don Quixote“ purer Gilliam – und eine mutige, exzentrische Adaptation.
Sie sind Geschichten der Besessenheit, des Ringens mit dem künstlerischen Selbst, eines Wunsches nach dem Unmöglichen, eines fast mystischen Aus-sich-Herausgehens: die Geschichten dieser Projekte, die Jahre, gar Dekaden von künstlerischer Kraft verbrauchten und die immer wieder verworfen und neu aufgenommen wurden.
Oft bangt man dann zu Recht auch um das Endprodukt: François Weyergans hat über 13 Jahre an seinem Roman „Trois jours chez ma mère“ gebastelt, das Endresultat war ganz nett, aber kein Meisterwerk. Guns n’ Roses’ „Chinese Democracy“ soll hier am besten in den Mantel des Schweigens gehüllt werden. Wenn sich ein versponnener Träumer wie Terry Gilliam vornimmt, die Abenteuer des Vaters aller versponnenen Träumer filmisch zu verewigen, dann konnte dabei eigentlich nur entweder ein Meisterwerk oder eine aussichtslose Niederlage herauskommen. Folglich war es bei „The Man Who Killed Don Quixote“ fast schon Teil des Projekts, dass hier alles schiefgehen musste, was nur konnte.
Der erste konkrete Versuch, das Projekt zu verfilmen, scheiterte so kläglich, dass ein 90-minütiger Dokumentarfilm diesen Fehlschlag festhielt. Sich „Lost in La Mancha“ anzuschauen, ist ungefähr so schmerzhaft wie einem Kumpel, den man mag, nachzusehen, wie er trotz offensichtlicher Aussichtslosigkeit immer wieder versucht, die Frau seiner Träume zu verführen. Mit 32 Millionen Dollar war das rein europäische Budget zwar durchaus groß, laut Gilliam hätte es aber das Doppelte benötigt, um den Film, der seit vielen Jahren in seinem Kopf herumspukte, zu realisieren.
Nach diesen initialen finanziellen Dämpfern sollte sich der Dreh als eine Anwendung von Murphy’s Law erweisen, ein Paradebeispiel dazu, wie unerbittlich die Wirklichkeit sein kann. Zu Kontraktproblem gesellten sich Versicherungs- und Produktionsschwierigkeiten, die weder Verspätungen noch sonstige Zwischenfälle tolerierten. Als dann aber Jean Rochefort auch noch mit Gesundheitsproblemen diagnostiziert wurde, folglich kein Pferd mehr montieren durfte und ein Unwetter den staubigen Drehort im zum Drehmonat eigentlich stets sonnigen Spanien in eine morastige Schlammlandschaft verwandelte, konnte man schon an einen Fluch glauben.
Problematisch war im Endeffekt, dass das Projekt sowohl zu konkret (32 Millionen Dollar zu konkret, um genau zu sein) und nicht konkret genug war. Nach dem Abbruch des Drehs lagen die Rechte für „The Man Who Killed Don Quixote“ beim Versicherer. Keine sechs Monate später versuchte Gilliam bereits mit neuen Investoren, sich den Quichotte wieder an sich zu reißen.
Für jemanden, der Gilliam kennt, ist diese Besessenheit nicht erstaunlich. Beim früheren Monty-Python-Mitglied gibt es eine fast schon pathologische, definitiv faszinierende Verwischung der künstlerischen Projekte und der Figuren, die der Regisseur von „The Fisher King“, „12 Monkeys“ oder auch „Fear and Loathing in Las Vegas“ porträtiert. Gilliams Figuren sind Autisten, die sich der Fiktion und ihrer Vorstellungskraft bedienen, um Fantasiewelten zu schaffen, die oftmals zu einsamen Gefängniszellen oder zu Labyrinthen ohne Ausgang werden. Gilliam scheint die gleichen Probleme mit den (wirtschaftlichen) Gesetzen der Außenwelt zu haben: In „Lost in La Mancha“ gibt er zu verstehen, dass ihn stets nur die unmöglichen Projekte fasziniert haben.
Die hier resümierten Geschehnisse sind so passend, weil sie die Quichotte-Abenteuer auf der Produktions- und Entstehungsebene verdoppeln und man fast glauben könnte, Gilliam hätte die Missstände absichtlich herbeigerufen, um die Verstrickung der Metaebenen, die man nun auch in seinem fertigen Film vorfindet, noch weiter zu treiben.
Der unmögliche Film
Denn schlussendlich hat es geklappt, und nachdem der Film eine allerletzte Hürde überschreiten musste – Produzent Paul Branco hat eine (am letzten Freitag verworfene) Klage eingereicht, um die Projizierung auf der Croisette und in Frankreichs Kinos zu verbieten –, kommt die Welt nach mehr als einem Vierteljahrhundert endlich in den Genuss von Gilliams von Katastrophen geplagten Werk. Und die Meinungen gehen jetzt schon auseinander: Libération spricht von einem Post-Kino-Werk, das den letzten Sargnagel der klassischen Fiktion darstellt, Le Monde erwähnt im Gegenzug ein gelungenes Werk, das die Etappen des Scheiterns konsequent mit einwebt und verstrickt.
Nachdem John Hurt und Robert Duvall die Rolle von Jean Rocheforts Quichotte und Owen Wilson und Ewan McGregor Johnny Depps Rolle als Sancho Panza alias Toby angeboten bekamen, sind es nun Adam Driver und Jonathan Pryce, die die beiden Hauptfiguren personifizieren.
Vergleicht man den Plot mit der Story, die Koautor Tony Grisoni in „Lost in La Mancha“ resümierte, merkt man, dass sich in den letzten 16 Jahren so einiges geändert hatte. Toby (Adam Driver) ist ein zynischer Ex-Filmstudent, der seine Talente mittlerweile nur noch in Werbefilmchen investiert. Man hat ihm aber erlaubt, einen Spielfilm zu drehen – und der skrupellose Womanizer hat sich für eine (Achtung, erste Metaebene) Don-Quichotte-Verfilmung entschieden.
Nachdem Toby am Ende des ersten Drehtags von einem Investor (Stellan Skarsgård) beauftragt wird, auf dessen Ehefrau (eine verführerische Olga Kurylenko, deren Figur leider die Tiefe einer Darstellerin in einem billigen Pornofilm hat) aufzupassen, stößt er auf eine DVD-Version eines Films namens (Achtung, zweite Metaebene) „The Man Who Killed Don Quixote“. Es handelt sich dabei um seinen eigenen Studienabschlussfilm, den er in derselben Gegend, in der auch jetzt gedreht wird, gefilmt hatte.
Aus Nostalgie und/oder Langeweile begibt er sich am Folgetag in das Dorf, wo er damals mangels finanzieller Mittel unter der spanischen Bevölkerung einen Schuster, dessen Gesicht ihm gefiel, für die Hauptrolle verpflichtete, obschon dieser sich in den filmischen Kampfszenen mit der Unbeholfenheit eines Monty-Python-Ritters durchschlug.
Bei seiner Rückkehr ins Dorf stellt er fest, welch verheerende Konsequenzen sein Film hinterlassen hat: Die damals 15-jährige Tochter des Wirts hat nach dem Dreh an eine Schauspielkarriere geglaubt und ist in Madrid als Escort-Girl gelandet. Und der Schuster hält sich seit geraumer Zeit für den wirklichen Don Quichotte und zieht erbarmungslos durch die Gegend, um die Welt nach seinen verrückten Fantasien zu leben. Als Toby ihm über den Weg läuft, wird er schnell in dessen verrückte Welt hineingezogen. Denn der realen Welt wird in Gilliams Quichotte nur ein kurzer Auftritt gewährleistet, um den Rahmen für die Story zu bieten. Danach stürzen wir uns via multipler Verwischungseffekte definitiv in die Welt der Vorstellungskräfte.
Ständig scheint es, als würde Toby zwischen der Welt diesseits und jenseits des berühmten Rabbit Holes wechseln, auch wenn die Wirklichkeit immer mehr phantasmagorische Züge annimmt. Im Laufe seiner schrägen Odyssee, die zum Teil natürlich auch Selbstfindung ist, begegnet Toby immer wieder Figuren aus seinem gegenwärtigen oder vergangen Leben. Wie auch bei „Fear and Loathing“ (aber hier ohne Drogen) werden diese aber schnell in die fiktionale Welt eingetaucht. Bei diesem Wechselspiel zwischen Wirklichkeit und Fiktion stellt sich immer verstärkt die Frage, wer hier die ungesundere Beziehung zu seiner Vorstellungskraft hat: der versponnene, aber an sich kindische, unschuldige Don Quichotte oder Toby, dessen fest verwurzelte Wirklichkeitsdarstellung eventuell auch nur einem verbissenen Konsens, der die eigenen Begierden favorisiert, entspricht – und die immer stärker abbröckelt.
In „Les mots et les choses“ beschreibt Michel Foucault den pikaresken Helden auf folgende Art: „Long graphisme maigre comme une lettre, il vient d’échapper tout droit du bâillement des livres. Tout son être n’est que langage, texte, feuillets imprimés, histoire déjà transcrite. […] Le livre est moins son existence que son devoir. Sans cesse il doit le consulter pour savoir que faire et que dire.“
Quichotte ist eine reine Textgestalt, ein Beweis, dass Derrida recht hatte, als er behauptete, es gebe nur Text. Weswegen „The Man Who Killed Don Quixote“ auch pures Kino ist – eine Reihe von imaginären Schwellen werden zu Beginn symbolisch überschritten, um uns in eine fast kindische Welt der puren Fiktion zu entführen. Von der verzerrten, heuchlerischen Welt der Werbebranche, in der seine erfundenen, lügnerischen Erzählungen – die Werbespots – immerzu der Ideologie des Kapitals unterliegen, gerät Toby in die ebenso verzerrte, aber naivere Innenwelt des Quichotte, in der die Wirklichkeit einer magischen Welt weicht.
Etwas voraussehbar ist das Ende des Films vielleicht schon. Im Endeffekt ist „The Man Who Killed Don Quixote“ aber, trotz einiger flacher Gags, zu schwachen Frauenfiguren und einem Adam Driver, der erstmals nicht ganz überzeugt, eine poetische Entführung in unsere Kindheit, in eine Welt der Unschuld, in der die Fiktionalisierung der Außenwelt nicht pathologisch und gefährlich war, weil wir keine Verantwortung tragen mussten und so unseren Vorstellungen freien Lauf lassen konnten.
Die ganz Ungeduldigen können den Film jetzt schon im benachbarten Frankreich sehen.
Unzuverlässig – die Figur des Mythomanen
In Cervantes’ revolutionärem Werk ist der Hauptprotagonist gleich eine unzuverlässige Figur, deren Wirklichkeitsauffassung stets schief ist und deswegen hinterfragt werden muss. Seitdem gibt es in der Belletristik eine ganze Menge an Erzählfiguren, die den Leser und/oder sich selbst anlügen: Man denke beispielsweise an Nobelpreisträger Kazuo Ishiguros Figuren, die sich ständig anlügen, um den Scherbenhaufen des eigenen Lebens zu entgehen.
Hauptproblem bei einer Don-Quichotte-Verfilmung ist deswegen das Medium selbst – Kino kommt bekanntlich nicht ohne Bilder aus. Und Bilder verraten weit mehr als jeder Text, sodass es eigentlich keine Verwirrung geben dürfte, die Verrücktheit der Figur zu offensichtlich auffliegt und die Wirklichkeit zu prosaisch mit Quichottes Welt kontrastiert. Sehen tut der Leser des Romans weder die Windmühlen noch die Fabelwesen, die Quichotte an ihrer Stelle sieht. Im Essay „Heterocosmica“ argumentiert Lubomir Doležel, dass wir wissen, dass es die Windmühlen gibt, weil der allwissende Erzähler Sancho Panza recht gibt, und nicht Don Quichotte.
Die momentane Unentschiedenheit, die in Büchern entstehen kann, gibt es im Film nicht. Dies war ein Hauptproblem von Fassbinders Nabokov-Verfilmung von „Despair“. In „Despair“ bringt ein Mann einen Obdachlosen um, der ihm verblüffend ähnlich sieht. Der Plan ist, so seinen Tod vorzutäuschen, um eine neue Existenz zu beginnen. Leider stellt sich heraus, dass der Obdachlose gar kein Doppelgänger war: Die Ähnlichkeiten spielten sich im Kopf des selbstbetrügerischen Mannes ab. Auch hier galt: Kein Problem im Roman – weil man da ja nichts sieht. Romane sind dunkel, Filme beleuchten. Gilliam löst dieses Problem, indem er die filmische Wirklichkeit so verzerrt, dass man bald nicht mehr weiß, ob Toby auch spinnt oder die Außenwelt von Quichottes Fiktionen angesteckt wurde.

 De Maart
De Maart








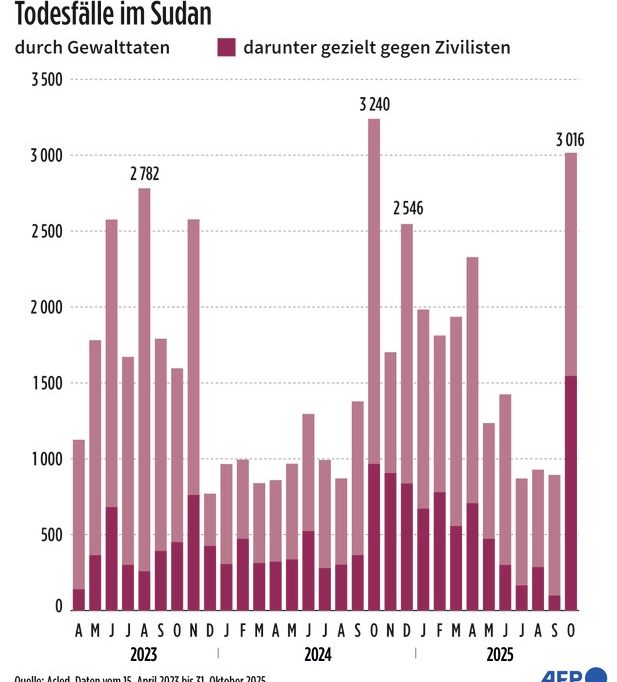
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können