1. Dezember 2025 - 7.04 Uhr
Luxemburger Experten im InterviewWarum Einsamkeit im Alter kein Randphänomen ist

Tageblatt: Welche Faktoren sind entscheidend für ein gutes Altern?
Alain Brever: Erstens: soziale Beziehungen pflegen und neue Freundschaften zulassen. Zweitens: ein gesunder Lebensstil. Drittens: finanzielle Stabilität. Diese drei Elemente sind zentral für erfolgreiches „Active Aging“.
Wenn wir über Vereinsamung im Alter sprechen, tauchen verschiedene Begrifflichkeiten auf. Können Sie erklären, worin die Unterschiede liegen?
A.B.: Einsamkeit ist ein Thema, mit dem wir sehr häufig konfrontiert sind – sowohl bei Menschen in Wohnstrukturen als auch bei jenen, die zu Hause leben. Dabei ist es wichtig, zwischen verschiedenen Formen zu unterscheiden: Meinen wir das subjektive Gefühl der Einsamkeit oder die objektiver messbare soziale Isolation?
Dr. Martine Hoffmann: Alleinsein, Einsamkeit und soziale Isolation sind drei unterschiedliche Konzepte. Alleinsein beschreibt einen objektiven Zustand – etwa, dass man gerade alleine in einem Raum ist. Einsamkeit bezeichnet das emotionale Empfinden, dass das Bedürfnis nach sozialer Resonanz nicht erfüllt wird. Soziale Isolation wiederum beschreibt eine geringe Anzahl sozialer Kontakte.
Einsamkeit als Gefühl ist nicht automatisch negativ. Es ist eine funktionale Emotion. Solange dieser Zustand nicht chronisch wird, kann er uns motivieren, aktiv zu werden. Bleibt das Gefühl jedoch bestehen und man verharrt darin, wird es schnell lähmend. Der Antrieb, etwas zu verändern, nimmt dann ab – und das kann sich Richtung Depression entwickeln. Die Forschung zeigt: Chronische Einsamkeit aktiviert im Gehirn dieselben Bereiche wie körperlicher Schmerz. Für den Körper bedeutet das Dauerstress, der Herz-Kreislauf-System und Immunsystem belastet. Es ist ein ernstes Problem, das oft unterschätzt wird. Denn wer lange einsam ist, zieht sich immer weiter zurück – man wird gewissermaßen unsichtbar. Dadurch wird Hilfe schwieriger zu erreichen.
Greifen diese Bereiche ineinander?
M.H.: Ja, sie sind nicht trennscharf. Sie können sich überschneiden und gegenseitig verstärken.
Wenn eine Person in einer Struktur Einsamkeit erlebt – gibt es dort Menschen, die gezielt auf sie zugehen?
A.B.: Wohnstrukturen wurden unter anderem geschaffen, um soziale Isolation zu vermeiden. Hier kommt man zwangsläufig mit anderen Menschen in Kontakt. Im betreuten Wohnen mietet man sich ein Zimmer, kann verschiedene Angebote nutzen – etwa Wäscherei, Essen oder Aktivitätenprogramme. Wie genau das aussieht, hängt von der jeweiligen Einrichtung ab. Im klassischen Altersheim ist das Angebot umfassender: Dort gibt es Pfleger, Pädagogen, Therapeuten, ganze Aktivitätsprogramme. Dazu kommen Dienstleistungen der Pflegeversicherung. Menschen, die noch nicht auf pflegeversicherte Leistungen angewiesen sind, sind meist mobil genug, um externe Angebote zu nutzen – etwa den „Club Actif+“ oder Aktivitäten der Gemeinden und Seniorenvereine.
Aber nur weil es Angebote gibt, heißt das nicht, dass sie auch genutzt werden.
A.B.: Genau. Es braucht immer auch persönliches Engagement, um Unterstützung anzunehmen. Manchmal fehlen dazu Motivation, Kraft oder Möglichkeiten. Dann rutschen Menschen leichter durchs Raster.
Was tun, wenn ältere Menschen diese Angebote nicht wahrnehmen können oder wollen?
A.B.: Jeder in unserer Gesellschaft trägt Verantwortung. Wir wissen nicht immer, wer einsam ist – viele Betroffene sind unsichtbar. Die Institutionen sehen nicht in jedes Haus hinein. Deswegen trägt jede und jeder die Verantwortung, hinzuschauen. Gleichzeitig sollte niemand erwarten, dass man „von außen“ an die Hand genommen wird. Unsere Gesellschaft ist zu groß dafür. Auch im Alter sind eigene Initiativen wichtig.
M.H.: Als Bürgerin oder Bürger sollte man aufmerksam sein. Es geht nicht darum, jemanden komplett zu betreuen – aber darum, einen Impuls zu geben: eine Telefonnummer weitergeben, zu einer Aktivität einladen, eine Brücke bauen.
Spielt das Geschlecht eine Rolle?
M.H.: Die Studienlage ist uneindeutig. Insgesamt sind Frauen häufiger einsam als Männer, doch rund um das Renteneintrittsalter trifft es Männer oft stärker – weil viele ihrer sozialen Kontakte an den Arbeitsplatz gebunden waren. Wenn diese plötzlich wegfallen und der Übergang nicht vorbereitet wurde, entsteht schnell Einsamkeit.
A.B.: Wir sehen allerdings auch, dass Frauen deutlich häufiger an Konferenzen zu Active Aging oder Gesundheit teilnehmen. Sie setzen sich intensiver mit Vorsorge auseinander – und profitieren davon.
M.H.: Im höheren Alter gleicht sich das aus. Frauen leben jedoch meist länger. Wenn der Partner als wichtigste Ressource wegfällt, führt das oft zu Einsamkeit. Im hohen Alter tiefgehende Beziehungen neu aufzubauen, ist schwierig: Es fehlen Energie, Zeit und emotionale Kapazität.
Einsamkeit bei Männern ist aber insgesamt ein großes Tabu. Traditionelle Männerbilder – stark, emotionslos, eigenständig – verhindern oft, dass Hilfe angenommen wird. Wir müssen dieses Bild öffnen und humanisieren.
Welche Risikofaktoren begünstigen soziale Isolation?
M.H.: Sprachbarrieren sind ein großes Hindernis – besonders für Menschen mit Migrationsgeschichte. Finanzielle Ressourcen bestimmen ebenfalls, welche Angebote man nutzen kann. Minderheiten sind generell stärker gefährdet, da sie oft mit dem Gefühl kämpfen, nicht dazuzugehören.
A.B.: Die Herausforderungen ähneln denen anderer Altersgruppen. Inklusion betrifft auch ältere Menschen. Gemeinden investieren derzeit viel in Mobilität und Barrierefreiheit. Eine altersgerechte Gesellschaft bedeutet, dass Angebote auch erreichbar sind – sonst nützen sie nichts. Hier wurden in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt.
Wie groß ist das Problem der sozialen Isolation in Luxemburg?
M.H.: Statistisch liegt Luxemburg mit etwa 14-16 Prozent im europäischen oberen Mittelfeld. Das ist nicht wenig. Es ist ein globales Problem, das wir ernst nehmen müssen. Es braucht einen Mentalitätswechsel – wir müssen uns wieder mehr füreinander öffnen.
A.B.: Die Gesellschaft hat sich in wenigen Generationen stark verändert. Früher lebten oft mehrere Generationen unter einem Dach, ältere Menschen hatten einen festen Platz in der Familie. Heute arbeiten alle, niemand ist zu Hause, die Pflege der älteren Mitmenschen wird ausgelagert. Mit dem Rückgang von Vereinen und Dorfleben gehen auch natürliche Treffpunkte verloren. Viele Gemeinden versuchen deshalb, aktiv gegenzusteuern und neue Orte der Begegnung zu schaffen – um das wiederaufzubauen, was früher selbstverständlich war.
Inwiefern spielt die zunehmende Digitalisierung bei diesem Thema eine Rolle?
M.H.: Die entscheidende Frage lautet: Ist Digitalisierung Teil des Problems oder Teil der Lösung? Wahrscheinlich beides. Digitale Mittel können sehr hilfreich sein – vorausgesetzt, sie bringen den Menschen auch im analogen Alltag etwas. In den letzten Jahren wurden große Anstrengungen unternommen, um digitale Barrieren abzubauen und die Inklusion zu verbessern.
A.B.: Wer möchte, findet heute problemlos einen Computerkurs. Aber nicht jeder will oder kann daran teilnehmen – was nachvollziehbar ist. Die Herausforderung besteht darin, dass unser Alltag immer digitaler wird, während die Nutzung digitaler Geräte auch Wissen über Cybersicherheit erfordert. Für Menschen, die nicht als Digital Natives aufgewachsen sind, ist das eine erhebliche Hürde.
M.H.: Und wichtig ist: Man hat das Recht, nicht digital leben zu wollen. Darum müssen Informationen weiterhin auch auf Papier verfügbar sein. Unternehmen sollten sich zudem bewusst sein: Mit der zunehmenden Digitalisierung fallen auch alltägliche soziale Kontakte weg. Und dann sind wir wieder beim Thema Einsamkeit und soziale Isolation.

 De Maart
De Maart







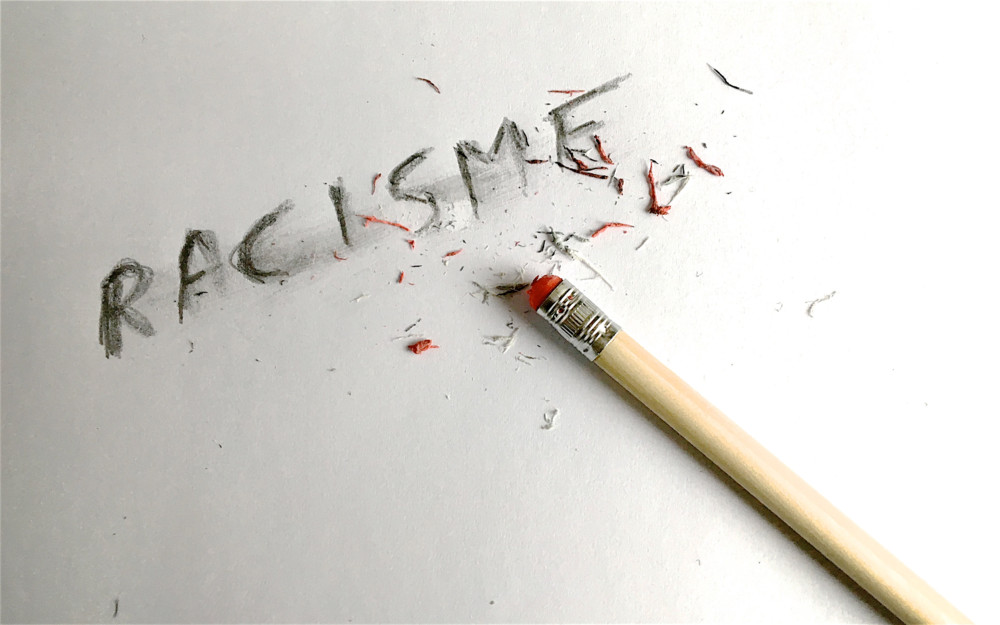
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können