Es ist geschafft: Fast neun Monate nachdem die Caritas-Spezialkommission ins Leben gerufen wurde, kommt ihre Arbeit zu einem Ende. Im Abschlussbericht, der dem Tageblatt vorliegt, fasst die Berichterstatterin Taina Bofferding (LSAP) die Ergebnisse zusammen – und regt zu Reflexionen über die Eignung des Instruments des Sonderausschusses an. Der jetzige Zeitpunkt biete eine gute Gelegenheit, „die Angemessenheit der derzeit von der Abgeordnetenkammer vorgesehenen Mittel zu überprüfen“.
Denn wenn die Spezialkommission eine Erkenntnis zutage gefördert hat, dann ist es diese: Die eine Perspektive auf die Ereignisse des vergangenen Sommers gibt es nicht. Nicht einmal bei den Vertretern der Caritas selbst. Die Arbeit der Kommission hinterlässt viele Fragen, ein paar Antworten und nicht wenige Widersprüche.
Zwischen Oktober 2024 und Mai 2025 traf sich die Kommission regelmäßig mit verschiedenen Akteuren, die in irgendeiner Form in den Skandal involviert waren – oder mit ihrer Expertise zu einer Aufklärung beitragen können. So sind etwa Vertreter der Caritas-Stiftung, des Erzbistums, der Regierung, der Justiz, der betroffenen Banken, der Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers oder vom OGBL einer Einladung der Kommission gefolgt.
Immer wieder Hürden
„Insgesamt war die Sonderkommission ‚Caritas‘ in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen“, steht im Bericht. Doch fast im gleichen Atemzug steht die Frage im Raum, ob die Arbeit nicht von einer anderen Art von Ausschuss hätte übernommen werden können. Denn die Kommission traf immer wieder auf Hürden, weil ihre Arbeit nicht „mit laufenden Ermittlungen und Gerichtsverfahren kollidieren“ durfte.
Davon lassen sich zahlreiche Beispiele im Abschlussbericht finden. So konnte die Spezialkommission zwar Widersprüche in einigen Erklärungen von Eingeladenen während einer Sitzung feststellen. Doch dabei bleib es dann auch. Aufgeklärt werden konnten die Widersprüche nicht. Auch war die Kommission mit Schwierigkeiten konfrontiert, während ihrer Arbeit Einblick in bestimmte vertrauliche Dokumente zu erhalten, die nicht veröffentlicht werden sollten.
Die einzig andere Möglichkeit, statt einer Sonderkommission, sei laut dem Bericht ein Untersuchungsausschuss gewesen – und der sei im Caritas-Fall „nicht angemessen gewesen“. Denn eine Untersuchungskommission hat die gleichen Befugnisse wie ein Untersuchungsrichter in Straffällen. Damit wäre er den Untersuchungen der Justiz in die Quere gekommen.
Die eingeschränkten Handlungsbefugnisse der Spezialkommission haben die Mitglieder dazu angeregt, über die Formen von Ausschüssen nachzudenken. Denn ein Sonderausschuss sei hauptsächlich dafür konzipiert worden, sich mit Gesetzgebungsdossiers zu befassen. Eine neue Form von Ausschuss könnte deswegen laut Bericht sinnvoll sein. Angesiedelt irgendwo zwischen den Befugnissen und Kompetenzen eines Sonderausschusses und denen eines Untersuchungsausschusses.

 De Maart
De Maart




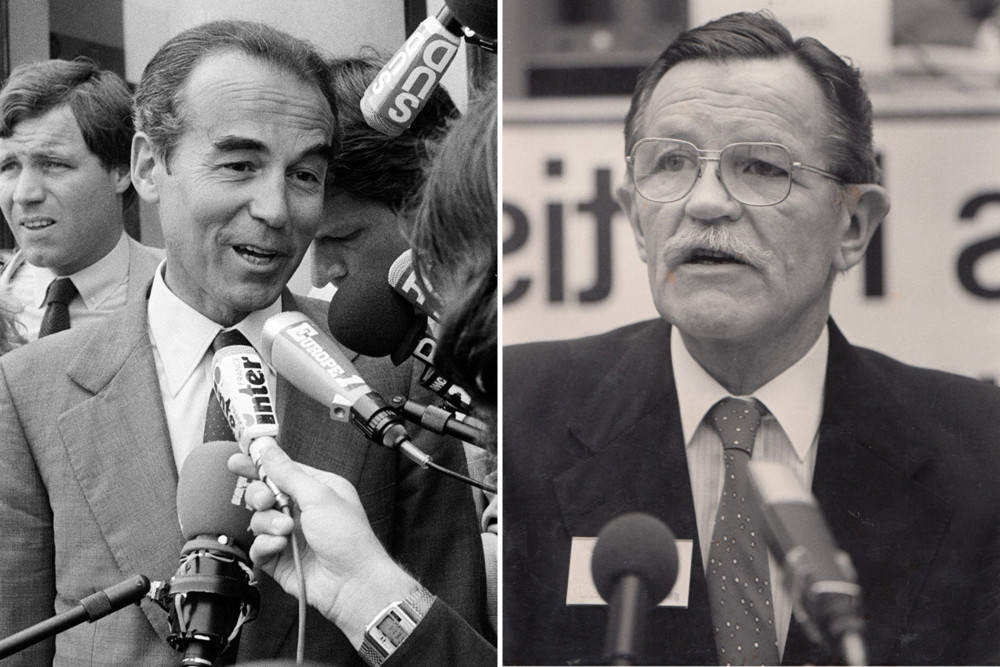




Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können