Die ITM hatte vorgestern eine Mitteilung auf ihrer Website mit der Ankündigung, sie habe am 1. Januar 2025 die Aufgabenbereiche und das Personal des „Service national de la sécurité dans la fonction publique“ übernommen. Unsere erste Anfrage bei der ITM, ob sie nun auch Kompetenzen in Sachen Mobbing im öffentlichen Dienst erhalte, wurde bejaht. Auf erneute Nachfrage hin hieß es jedoch, man wisse es noch nicht, man brauche erst noch mehr Informationen. Es bleibt also unklar, wer für Mobbingfälle im öffentlichen Dienst zuständig ist.
Die Abgeordneten der DP Gusty Graas und Fernand Etgen hatten im November eine diesbezügliche Frage an den Minister für den öffentlichen Dienst gestellt. Sie wollten u.a. wissen, welche Maßnahmen er zu ergreifen gedenke, und ob es nicht angebracht wäre, die ehemalige Spezialkommission, die Mobbingvorwürfe im öffentlichen Dienst untersuchte, wieder zu reaktivieren.
Eine unabhängige Sonderkommission, die parallel zu der existierenden Disziplinarprozedur arbeitet, sei nicht die effizienteste Lösung, da sie riskiere, die Dauer der Untersuchungen unnötig in die Länge zu ziehen, schreibt Serge Wilmes in seiner Antwort. Es werde dieses Jahr aber analysiert, wo die Schwächen der aktuellen Prozedur lägen, und wie man ihnen entgegenwirken könne.
Als empathie- und verantwortungslos verurteilte der OGBL den Minister daraufhin in einer Mitteilung. Aus Sicht der Gewerkschaft verweigert er Mobbingopfern im öffentlichen Dienst schlicht den nötigen Schutz. Das aktuelle System, das der Minister verteidigt, entmutige die Betroffenen, etwas zu sagen, und schütze die Täter.
Altes Problem
Dass Mobbing kein Randphänomen ist, zeigte bereits eine Veröffentlichung von 2019. Die „Chambre des salariés“ veröffentlichte damals den „Quality of work index“, eine Studie, der zufolge Luxemburg im europäischen Vergleich sehr schlecht dasteht. Unser Land lag hinter Frankreich an zweiter Stelle, was die Häufigkeit von Mobbing am Arbeitsplatz anging. Aus der Studie ging auch hervor, dass Angestellte im öffentlichen Dienst etwas häufiger darunter leiden als diejenigen im Privatsektor.
Vera Dockendorf vom OGBL erklärt die Schwächen der aktuellen Prozedur. „Das Problem ist, dass man einen Mobbingvorfall seinem direkten Vorgesetzten melden muss; doch in den meisten Fällen verläuft die Sache im Sand.“ Dies sei auch der Tatsache geschuldet, dass es an geschultem Personal mangelt. Die meisten Personen wüssten nicht, wann sie es mit einem Mobbingfall zu tun hätten. Bei den Gemeinden käme noch ein anderes Problem hinzu: Sei man dort weniger als zehn Jahre als Angestellter beschäftigt, genieße man quasi keinen Kündigungsschutz, und es komme vor, dass Personen, die sich wegen Mobbing beschwerten, im Nachhinein entlassen würden.
Der Privatsektor sei in Sachen Mobbing viel besser geschützt. Privatangestellte können sich in Mobbingfällen an die „Inspection du travail et des mines“ wenden. Angestellte bei den Gemeinden können sich allerdings weder an staatliche Instanzen noch an die ITM wenden.
Der OGBL fordert seit einiger Zeit eine unabhängige Anlaufstelle für Mobbingopfer im öffentlichen Dienst. Eine solche gab es bereits von 2007 bis 2014, dann wurde sie aus verfassungsrechtlichen Gründen wieder abgeschafft. Dockendorf erinnert auch an ein Gesetzesvorhaben aus dem Jahre 2017 des damaligen Ministers für den öffentlichen Dienst, Dan Kersch, zur Schaffung eines „Centre pour la sécurité, la santé et la qualité de vie au travail dans la Fonction publique“. Das Projekt habe unabhängige Untersuchungen in Mobbingfällen vorgesehen. Der Text wurde allerdings von der aktuellen Regierung wieder zurückgenommen.
Alain Colling, OGBL-Zentralsekretär für den öffentlichen Dienst, kritisiert vor allem, dass es auf Gemeindeebene überhaupt keine Prozeduren gebe; die Leute würden dort manchmal „wie auf heißen Kohlen sitzen“.
Auch er weiß: „Allzu oft werden solche Fälle kleingeredet; die Leute werden nicht ernst genommen.“
Dass wie im Fall Contern eine private Firma mit einer Untersuchung beauftragt wurde, sei nicht in Ordnung: „Eine Gemeinde kann sich doch nicht als Richter aufspielen. Die Firma behauptet, es habe kein Mobbing gegeben, aber das Resultat der Untersuchung bleibt unter Verschluss.“
Aktuell können sich Betroffene an den staatlichen „Service psycho-social“ wenden. Das sei nicht mehr als eine psychologische Stütze. „Wir brauchen ein Organ, dass auch Strafen verhängen kann. Es kann nicht sein, dass die Täter jeden Tag ‚de Schmu mat de Leit maachen’, und den Betroffenen nahegelegt wird, doch den Arbeitsplatz zu wechseln.“
ITM als Hoffnungsträger
Claude Reuter, Präsident der Gewerkschaft für das Gemeindepersonal FGFC, hat eine etwas andere Sicht der Dinge. „Ich verstehe die Antwort des Ministers insofern, als es eine alte Geschichte ist.“ Die Forderung nach einer unabhängigen Kommission wiederholt er nicht. Er hingegen setzt große Hoffnung in eine zukünftige Reform der ITM. Im Oktober hatten sich Vertreter der FGFC mit Arbeitsminister Georges Mischo getroffen. Bei der Unterredung ging es um die zukünftige Zuständigkeit im Gemeindewesen, insbesondere in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.
Dabei habe der Minister in Aussicht gestellt, dass auch die Zuständigkeit in Mobbingangelegenheiten im öffentlichen Dienst auf die ITM übertragen werden könnte. Die ITM wäre dann eine solche Anlaufstelle, wie sie auch vom OGBL gefordert wird.
Eine einzige Anlaufstelle befürwortet auch die Gewerkschaftssekretärin für den öffentlichen Dienst beim LCGB, Céline Conter. Sich an den direkten Vorgesetzten wenden zu müssen, sei nicht gut. „Es braucht definitiv eine außenstehende Person, die einen ungetrübten Blick auf die Situation hat.“ Auch sie verweist darauf, dass vor allem Gemeindeangestellte in einem Mobbingfall die meisten Probleme hätten, Gehör zu finden. Dass Kompetenzen in Sachen Mobbing der ITM übertragen würden, könnte auch sie sich vorstellen. Ob sie die Kompetenzen nun erhält, bleibt also abzuwarten.

 De Maart
De Maart

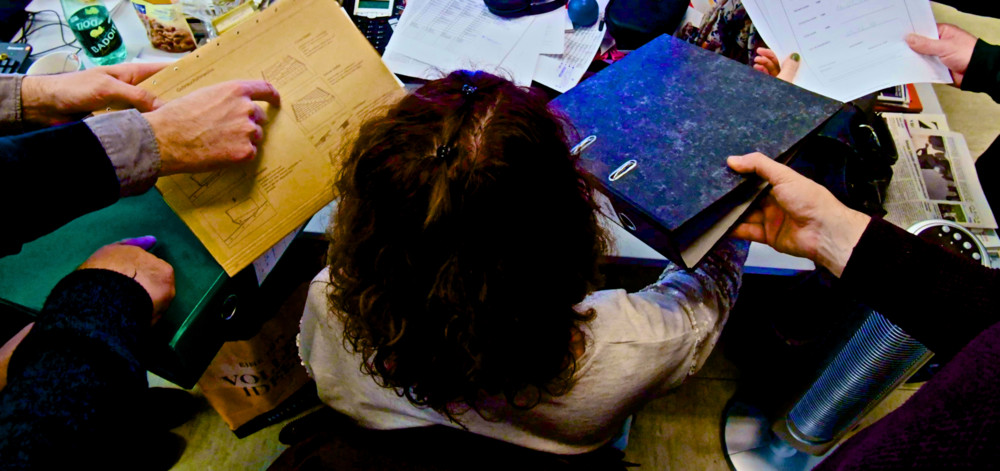

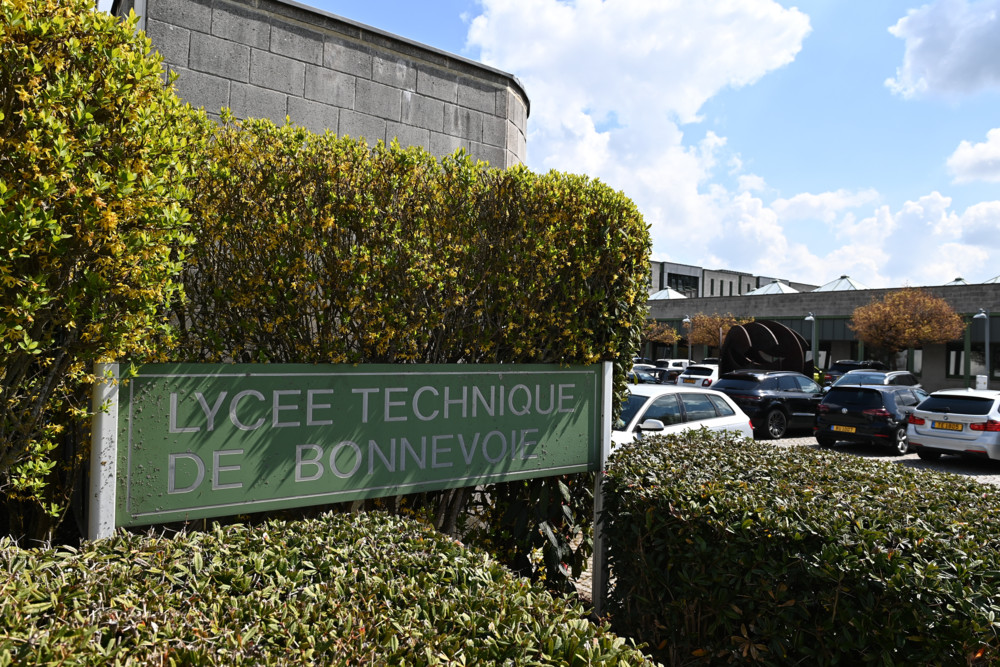





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können