„Das Kulturministerium freut sich, die Online-Publikation der Bestandsaufnahme des Buch-, Literatur- und Verlagssektors bekannt zu geben“, hieß es am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung des Kulturministeriums zum „Etat des lieux – Secteur du livre, littérature et édition“. Hinter dem über 200-seitigen Dossier steckt vor allem Fabienne Gilbertz (Centre national de littérature): Ihre Analyse des Sektors bildet laut Kulturministerium das „Kernstück“, hinzu kommen die Verschriftlichung der Debatte über die „Assises sectorielles du livre, littérature et édition“ (2023) und Statistiken. Die Bestandsaufnahme bezieht sich auf die Jahre 2019 bis 2022. An der Befragung beteiligten sich u.a. Mitglieder der Verbände „A:LL Schrëftsteller*innen“, „Fédération des éditeurs luxembourgeois“ und „Fédération des librairies“.
Worüber niemand spricht
Im Vorwort resümiert der zuständige Minister Eric Thill (DP) seinen Austausch mit dem Sektor: „Mes échanges avec les acteurs du livre ont révélé les défis actuels: la visibilité nationale de la littérature luxembourgeoise, la distribution internationale des livres, la petite taille des maisons d’édition manquant de ressources pour se développer, et les difficultés de recrutement en raison du manque de connaissance des métiers du livre.“ Für die Akteur*innen sind die größten Herausforderungen: hohe Lebenshaltungskosten, Nachhaltigkeit, die Frage der Qualität und Relevanz publizierter Texte.
Letzteres wird als Tabuthema in der Szene bezeichnet, über das nur „hinter vorgehaltener Hand“ diskutiert werde. „Es gibt kaum jemanden im Sektor, der verleugnen würde, dass es große Qualitätsunterschiede bei der Buchproduktion gibt“, steht in dem Bericht. Es sei vergleichsweise einfach, hierzulande zu publizieren, und der Veröffentlichung gehe „nicht immer eine eingehende Qualitätskontrolle“ voraus. Das öffentlich auszusprechen, traue sich bisher niemand – weil „man sich in einem kleinen Betrieb persönlich kennt“.
Hungerlöhne und Klischees
Mag dieses Thema delikat sein, ist ein anderes ein offenes Geheimnis: Nur 15 Prozent der Autor*innen (4 von 26), die sich an der Befragung beteiligten, beziehen den Großteil ihres Verdienstes durch das Schreiben. Lehrbeauftragte zählen zu der am stärksten vertretenen Berufsgruppe im Sektor. Die meisten (77 Prozent) Schreibenden verlangen bei Lesungen ein Mindesthonorar zwischen 90 und 500 Euro. Die Mehrheit (11 von 26) richtet sich nach der von „A:LL Schrëftsteller*innen“ verhandelten Summe von 400 Euro. In der Regel sind sie zudem zu 10 Prozent am Buchverkauf beteiligt.
An weiterer Stelle trifft ein Klischee der internationalen Literaturbranche auch auf Luxemburg zu: Männer sind in allen Genres überrepräsentiert, außer in der Kinder- und Jugendbuchliteratur. „In dieser Sparte haben Frauen mehr als doppelt so viele Publikationen vorzuweisen“, steht in dem Dossier. Davon abgesehen war im Zeitraum der Datenerhebung die meistgeschriebene Sprache Luxemburgisch (257 Publikationen), gefolgt von Deutsch (160 Publikationen) und Französisch (142 Publikationen). Am Ende noch eine Information in Eigensache: 2022 erschienen im Tageblatt mehr Literaturkritiken (54) als in jedem anderen luxemburgischen Medium. Das geht u.a. auf die Beilage „Livres/Bücher“ zurück, die vor Kurzem eingestellt wurde.
Die Komplettversion des „Etat des lieux – Secteur du livre, littérature et édition“ ist auf der Webseite des Kulturministeriums verfügbar und in Kürze in gedruckter Form erhältlich.

 De Maart
De Maart

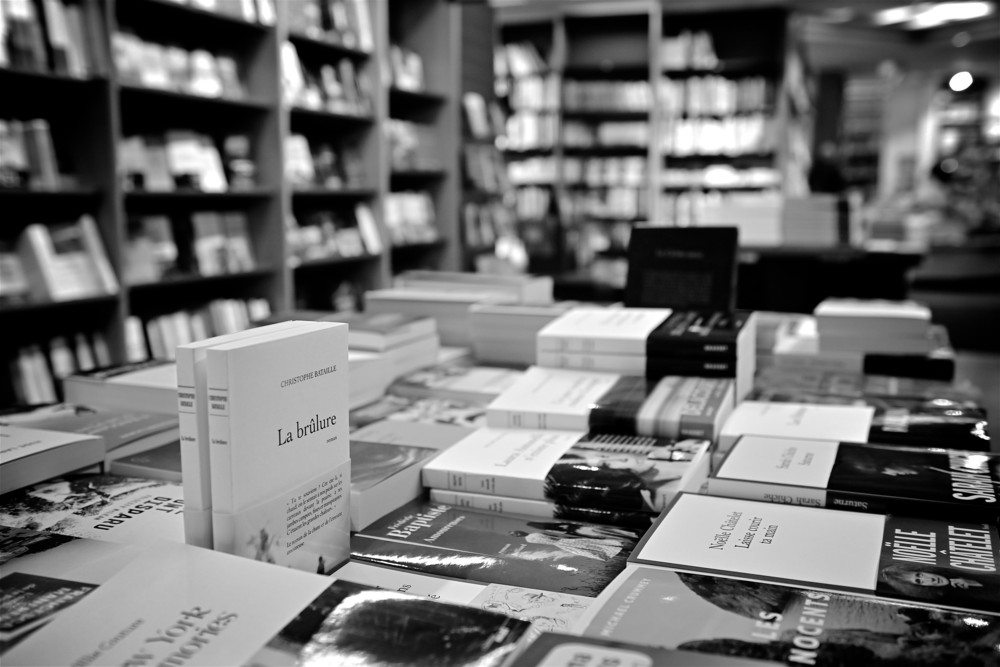







Ich gehöre zu denjenigen Autoren - in meinem Fall sind es wissenschaftliche oder allgemeinverständliche philosophische Werke -, für die das Schreiben eine Berufung und kein Beruf sein sollte. Kürzlich habe ich einem Verlag mitgeteilt, ich würde das mir angebotene, relativ attraktive, Honorar ablehnen, da ich nicht für mein Schreiben mit Geld bezahlt werden will, höchstens mit Büchern, die ich mir auswähle im Verlagskatalog. Aber der Verlag wollte nicht, da es bürokratisch nicht machbar war. Bei Oxford University Press ist das anders: die haben mir die Wahl gelassen zwischen 500 $ oder Bücher für diese Summe, als Gegenleistung für einen Beitrag zu einer online Bibliografie. Kurzum: Ich betrachte das Schreiben für Geld als eine Art intellektueller Prostitution. Und ich denke, dass heute viel weniger publiziert werden würde, wenn manche Leute sich nicht den Reichtum von ihren Werken erwarten würden. Und das wäre gut für die Qualität der veröffentlichten Schriften jeder Art. Natürlich habe ich einen gut bezahlten Beruf. Aber keinem Autor ist verboten, auch einen Beruf auszuüben. Wem das Schreiben eine Leidenschaft ist, sollte sich mit der Produktion eines qualitativ hochwertigen Werkes zufrieden geben, das dann schon sein Publikum finden wird.