Der Frühling kam schneller als gedacht – und mit ihm die Pflanzenschutz-Saison. Eigentlich wollten wir bei Winzerin Corinne Kox nur nachfragen, welche Arbeiten in den kommenden Wochen auf uns zukommen würden. Doch schon am Telefon klang sie äußerst beschäftigt: „Wir müssen wohl morgen bereits anfangen, einige Parzellen mit Pflanzenschutzmitteln zu behandeln“, sagte sie. Das warme Wetter der vergangenen Woche und der drohende Wetterumschwung machten präventive Maßnahmen gegen Pilzkrankheiten notwendig.
Wir selbst hatten uns mit dem Thema bislang nur oberflächlich beschäftigt. Spritzen dürfen wir ohnehin nicht selbst: Seit 2021 ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur noch Inhabern des sogenannten „Sprëtzpass“ erlaubt. Dieser wird nach einer Schulung beim Institut viti-vinicole (IVV) vergeben, wo alle Aspekte des Rebschutzes behandelt werden – vom sicheren Umgang mit Pflanzenschutzmitteln über gesetzliche Grundlagen bis hin zur Prognose von Krankheiten mithilfe des Modells „VitiMeteo“.

Domaine-Tageblatt-Newsletter
Das Projekt ist ambitioniert und soll Einblicke in die Welt der Winzer verschaffen. Die Tageblatt-Redaktion wird in den kommenden anderthalb Jahren versuchen, ihren eigenen Wein herzustellen, in einer wöchentlichen Serie über Erfolg und Misserfolg berichten und dabei tiefere Einblicke in die Welt des Weinbaus geben.
Bleiben Sie über unsere Erfolge und Misserfolge informiert. Hier geht’s zu unserem Newsletter: Link.
Ohne Schutz keine Ernte
Pflanzenschutz ist in der Öffentlichkeit umstritten – viele Konsumenten blenden das Thema lieber aus. Doch Mareike Schultz, Beraterin für ökologischen Weinbau beim IVV, stellt klar: „Ohne Pflanzenschutz gäbe es in Luxemburg keinen Weinbau.“ Besonders die Pilzkrankheiten Peronospora (Falscher Mehltau) und Oidium (Echter Mehltau) führen regelmäßig zu Ernteausfällen. In niederschlagsreichen Jahren wie 2024 steigt das Risiko deutlich.
Folgen des Klimawandels
Die Auswirkungen des Klimawandels stellen die Winzer beim Thema Rebschutz vor Herausforderungen, wie Mareike Schultz vom IVV erklärt. „Steigende Temperaturen wirken sich beispielsweise auf das Auftreten von Schädlingen aus. Durch die milderen Temperaturen in den Wintermonaten fällt es invasiven Arten leichter, sich an der luxemburgischen Mosel zu etablieren. Beispiele dafür wären der Bekreuzte Traubenwickler, der seit 2015 erfolgreich mit Pheromonen bekämpft wird, oder auch die Kirschessigfliege, die immer wieder für Probleme an früh reifenden roten Rebsorten sorgt.“ Auch die Niederschläge und ihre Verteilung haben sich in den vergangenen Jahren verändert. „Einzelne Jahre bleiben als extrem nass in Erinnerung, die Weinbergsböden sind durch den Regen kaum befahrbar, während extreme Infektionsbedingungen herrschen. 2016 war beispielsweise ein extremes Peronospora-Jahr. In anderen Jahren tritt genau das Gegenteil auf und es herrschen extrem trockene und heiße Bedingungen“, so Schultz, die auf die zunehmende Häufigkeit von lokalen Extremniederschlagsereignissen hinweist. „Dies erfordert enorme Flexibilität und Wachsamkeit der Winzer. Sie müssen die Witterung und ihre Weinberge sehr genau im Blick halten und ihre Pflanzenschutzstrategie an die Bedingungen anpassen.“
Damit räumt die Expertin auch mit einem weitverbreiteten Irrtum auf: Biowein bedeutet nicht, dass keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Auch unsere Tageblatt-Parzelle, die ökologisch bewirtschaftet wird, muss regelmäßig behandelt werden – nur eben mit anderen Mitteln. „Der Begriff ‚konventioneller Weinbau‘ ist überholt“, erklärt Schultz. Heute unterscheidet man zwischen integriertem und ökologischem Pflanzenschutz.
Integrierter Pflanzenschutz kombiniert biologische, biotechnische und kulturtechnische Methoden mit einem minimalen Einsatz chemischer Mittel. Im ökologischen Weinbau sind nur wenige Wirkstoffe zugelassen – hauptsächlich Kupfer und Schwefel. Diese sogenannten Kontaktmittel bleiben an der Oberfläche der Pflanzen und werden nach Regen abgewaschen, was häufigere Behandlungen nötig macht. „Salopp gesagt: Die Mittel im Bioweinbau sind weniger potent und müssen demnach öfter angewendet werden“, so Schultz.

Eine Sache der Experten
Bleibt die Frage: Ist Kupfer als Schwermetall nicht eine Gefahr für den Boden? „Kupfer ist in allen weinbaulich genutzten Böden vorhanden – das ist historisch bedingt“, erklärt Schultz. Heute sei der Einsatz jedoch streng reglementiert: In einem Zeitraum von sieben Jahren (bis 2026) dürfen maximal 28 Kilogramm Reinkupfer pro Hektar aufgebracht werden – im Schnitt also vier Kilogramm pro Jahr. Meist liegt der tatsächliche Wert deutlich darunter.
Doch Pflanzenschutz endet nicht beim Einsatz von Spritzmitteln. Auch anbautechnische Maßnahmen spielen eine große Rolle – etwa eine gut durchlüftete Laubwand, die nach Regen schnell abtrocknet und so das Risiko von Pilzinfektionen senkt. Schultz rät uns deshalb: „Für euren Rivaner sollte eine sachkundige Person den Pflanzenschutz übernehmen.“ Bei der Komplexität des Themas ein wohl sehr vernünftiger Ratschlag.
Piwis als Hoffnungsträger
Weinbau ganz ohne Pflanzenschutz – das bleibt zumindest in Luxemburg vorerst unrealistisch. Doch es gibt Ansätze, den Aufwand zu reduzieren. Eine Option sind sogenannte Piwi-Rebsorten (pilzwiderstandsfähige Sorten). „Diese Züchtungen bringen von Natur aus eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Pilzkrankheiten mit“, erklärt Schultz. Sie müssen nur in der empfindlichsten Wachstumsphase behandelt werden.
Und auch geschmacklich haben sie aufgeholt: Aus Piwi-Trauben entstehen heute qualitativ hochwertige Weine. Ob sie sich durchsetzen, liegt letztlich an den Konsumenten – auch sie tragen Verantwortung beim Thema Pflanzenschutz.
Tipps und Feedback
Wollen Sie uns bei unserem Projekt unterstützen, uns Tipps und Feedback geben, dann kontaktieren Sie uns über unsere Facebook-Seite oder per E-Mail an [email protected].

 De Maart
De Maart



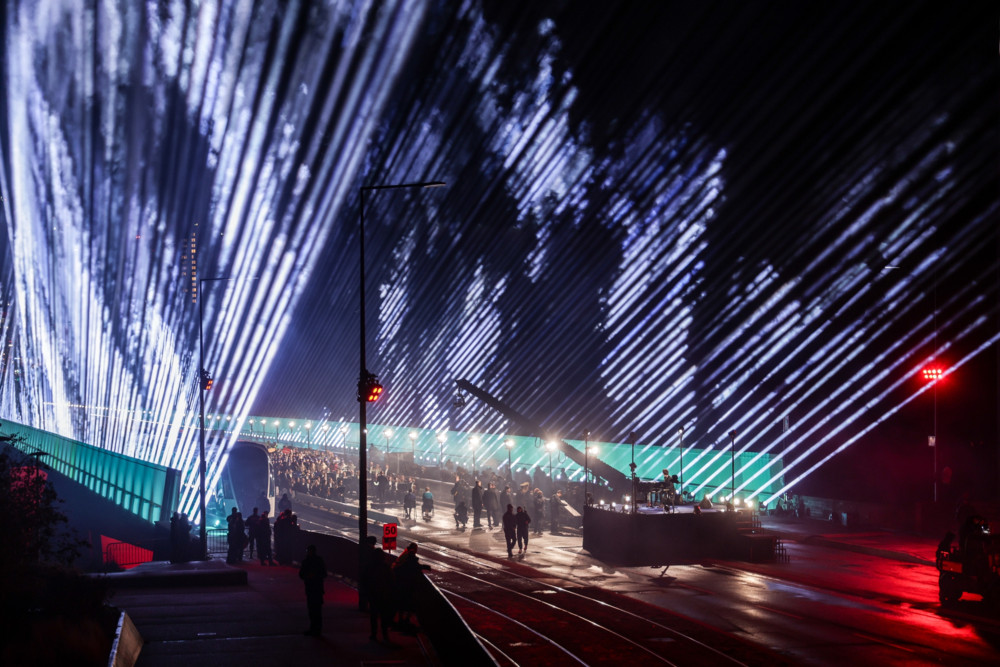





Frage: Warum kriege ich immer Sodbrennen wenn ich Weißwein einer hiesigen Genossenschaftskellerei trinke, vom privaten Winzer aber nicht?