
Als der französische Dichter und Schriftsteller André Breton mit seinem „Manifest des Surrealismus“ die Wirklichkeit auf den Kopf stellte und seine Bewegung das verdrängte Unterbewusste zum Vorschein brachte, hatten sich einige Künstler vor allem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden mit ihren sozialkritischen Bildern bereits auf die Welt des Sichtbaren zurückbesonnen. Mit ihren sozialkritischen Themen etablierten unter anderem Otto Dix, George Grosz und Christian Schad die führende Kunstrichtung der Weimarer Republik. Sie gehörte ebenso zu der Epoche, die retrospektiv oft die Goldenen Zwanziger bezeichnet werden und sich vor allem in den Metropolen und Großstädten abspielte, wie Börsencrash und Bubikopf, wie Inflation und rauschende Partynächte, oft mit „Babylon“ Berlin in Verbindung gebracht. Unter den gewaltigen gesellschaftlichen Umbrüchen jener Zeit fand die Neue Sachlichkeit nach den Aufbrüchen und Utopien der Avantgarde wieder zum Gegenständlichen des Alltagsobjekts, zu klaren Bildkonzepten und zu einer objektivierenden Darstellungsform zurück. Vorherrschend war ein Rückgriff auf Ordnungsprinzipien, die „retour à l’ordre“, die alle nicht-gegenständliche, abstrahierende Kunst ablehnte.
Vom Ersten Weltkrieg wachgerüttelt und selbst Zeugen, wie in den Roaring Twenties ethische Grundwerte verloren gingen und die einstige Weltordnung zerbrach, beobachteten die Künstler der Neuen Sachlichkeit die Gesellschaft aus einem sowohl anklagenden als auch satirischen Blickwinkel. Der aus Gera stammende Dix etwa schilderte in seinen Grafiken und Gemälden die grauenvollen Folgen des Krieges und den Menschen sowohl als Opfer wie auch als Täter. Der Berliner Grosz enttarnte die Ränke der Reichen und die Hohlheit des Patriotismus, aber auch die Verlogenheit der phrasendreschenden Bonzen, Politiker und Militärs, mit Bierkrug und Säbel sowie Hakenkreuz an der Krawatte, mit ihrer Heuchelei, ihrer Gier und ihrem Hass, zum Beispiel in „Die Stützen der Gesellschaft“ (1926).
Die Welt des Sichtbaren
Von großer Bedeutung war der aus Bremen stammende Kunsthistoriker Gustav Friedrich Hartlaub, der in Berlin studiert hatte und zuerst an der Kunsthalle seiner Heimatstadt sowie danach in der Kunsthalle Mannheim tätig war, deren Direktor er 1923 wurde. Zuerst setzte er sich für die Förderung des Expressionismus ein. Sodann eröffnete er am 14. Juni 1925 in der badischen Industrie- und Arbeiterstadt die Ausstellung „Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus“. Sie brachte eine Reihe von unterschiedlichen Künstlern zusammen. Hartlaub unterschied verschiedene Richtung der Neuen Sachlichkeit voneinander: die veristisch-gesellschaftskritische und die eher klassisch-konservative. Beide setzten auf einen, wie der Name der Kunstrichtung schon sagt, betont sachlichen Stil. Zum einen reflektierten die Künstler die gesellschaftlichen Verhältnisse, zum anderen die Grundhaltung des modernen Managers und Ingenieurs. Das Dinghafte, Nüchterne und Statische stand im Vordergrund. Emotionen galten als unsachlich. Der französische Kunsthistoriker Jean Clair stellte eine gewisse Melancholie im Ausdruck der Neuen Sachlichkeit fest, eine Interpretation, die nur wenige Anhänger fand, mit Ausnahme etwa der deutschen Kunsthistorikerin und Kuratorin Beate Reese.
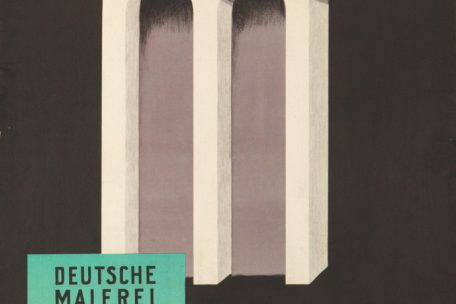
Ungefähr zeitgleich zur Neuen Sachlichkeit waren noch Expressionisten wie Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff oder Max Pechstein sehr anerkannt. Der Untertitel „Deutsche Malerei nach dem Expressionismus“ war folglich etwas irreführend. Zwar erregte 1929 im Amsterdamer Stedelijk Museum noch eine weitere Ausstellung großes Aufsehen und fand 1932 in Ulm die Schau „Die Hinwendung der Neuen Sachlichkeit zu einer neuen Romantik“ statt und wieder in Mannheim 1932/33 „Beschauliche Sachlichkeit“. Gustav Friedrich Hartlaub wurde jedoch im Zuge der nationalsozialistischen Machtergreifung im März 1933 entlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er noch als Professor in Heidelberg tätig. Das drohende Unheil hatte übrigens Otto Dix in den „Sieben Todsünden“ (1933) prophetisch beschworen.
Unter den Werken der Neuen Sachlichkeit besitzen Porträts, Landschaftsbilder, Stadtansichten und Stillleben einen hohen Anteil, aber auch die Aktmalerei. Hinzu kamen bis damals von der Kunst kaum thematisierte Elemente wie Litfaßsäulen, Reklameschilder, Fabrikarchitektur und neue Technologien. Die Kunstrichtung changierte im Spannungsfeld von Tradition und Moderne, von Melancholie und Fortschrittsglauben. Ob als Gegenbewegung zum Futurismus und Expressionismus – die detailgenaue Darstellung des großstädtischen Alltags als Ort extremen Erlebens wie etwa bei Dix, wenn auch in seiner Erstarrung befremdlich, faszinieren noch heute. Die bissigen, satirischen, fast karikaturhaften Kommentare zur gesellschaftlichen Lage von damals, zwischen Armut und Kriegsgewinnlern, wirken durch den scharfen Strich manchmal entrückt, besitzen aber eine deutliche Präsenz.
Jubiläum der legendären Schau

Von den Originalen, die in der Mannheimer Schau 1925 zu sehen waren, zeigt die Mannheimer Kunsthalle noch bis zum 9. März in der Ausstellung „Die neue Sachlichkeit – Ein Jahrhundertjubiläum“ 24 Werke, ergänzt durch zahlreiche weitere Gemälde, die der Neuen Sachlichkeit zuzuordnen sind. Kuratorin ist Inge Herold, stellvertretende Direktorin der Kunsthalle. Mit dabei sind unter anderem das legendäre „Bildnis der Tänzerin Anita Berber“ (1925) von Dix, das Symbol eines weiblichen Vamps, das damalige Lebensgefühl zwischen Abgrund und Ekstase vermittelnd, aber auch „Grauer Tag“ (1921) zwischen Schornsteinschloten von Grosz, ein „Stillleben“ (1926) mit Blumen, Eimer, Zeitungen und Putzlappen von Herbert Ploberger, „Selbstbildnis vor der Litfaßsäule“ und „Von kommenden Dingen“ (beide 1926) von Georg Scholz, der ursprünglich aus Wolfenbüttel stammte, sich aber an der Badischen Landeskunstschule Karlsruhe ausbilden ließ und sich der Künstlergruppe Rih anschloss, „Der Betrunkene“ (1924) von Otto Ritschl, der von der 1925er-Ausstellung enttäuscht war und sich selbst später mehr der Abstraktion zuwandte, „Wirtshaustheke“ (1927) von Erich Wegner, der auch einer der herausragenden Vertreter der Neuen Sachlichkeit war, wie Christian Schad, der nicht an der 1925er-Ausstellung teilnahm, sich in München ausbilden ließ, im Züricher Cabaret Voltaire ebenso wie in Schwabinger Kreisen verkehrte, die mondäne Seite der Kunst in den Vordergrund richtete und mit Bildern wie „Sonja“ (1928), einer Frau mit Bubikopf und Zigarette, stilbildend war. Ebenso vertreten sind einige lange vergessene oder vernachlässigte Künstlerinnen, die nicht in der Schau von 1925 vertreten waren, wie ein „Selbstbildnis als Malerin“ (1935) von Kate Diehn-Bitt, „Bildnis Robert von Mendelssohn“ (1928) von Ilona Singer oder „Russisches Mädchen mit Puderdose“ (1928) von Lotte Laserstein. Sie wurde eine der wichtigsten Repräsentantinnen der Epoche. Gezeigt werden zudem Werke von Max Beckmann und Pablo Picasso.


 De Maart
De Maart






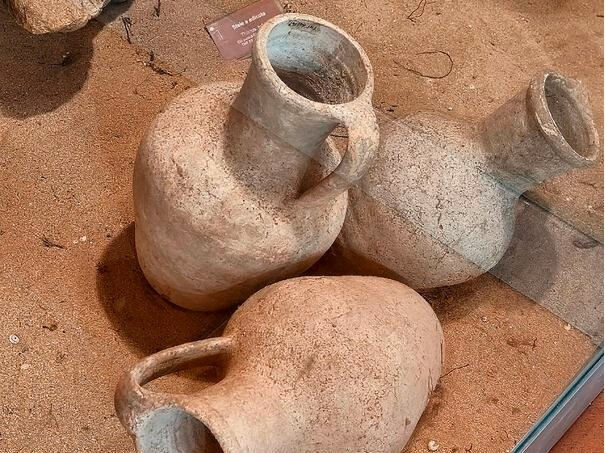


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können