Tageblatt: Herr Scheeck, als Generalsekretär sind Sie ganz nah dran am Parlament, am Zentrum der luxemburgischen Demokratie. Ich bin neu im Land und in seiner Politik. Wie würden Sie für jemanden wie mich die vergangene Legislaturperiode in zwei Sätzen zusammenfassen?
Laurent Scheeck: Ich würde sagen, dass man trotz einer ganzen Reihe von Krisen – Covid, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, geopolitische Veränderungen, die einen großen Einfluss auf die offene luxemburgische Gesellschaft und Wirtschaft hatten – im Parlament gesehen hat, dass uns zwei Sachen ganz besonders am Herzen liegen: Demokratie und Stabilität. Dass wir mit den politischen Debatten, die sich im Parlament entfaltet haben, zwischen den Abgeordneten und der Regierung, zwischen der Mehrheit und der Opposition, dazu beigetragen haben, unsere Demokratie hochzuhalten in diesen Krisen und auch in der Transitionszeit, in der wir leben. Durch eine Debattenkultur, die wir vielleicht so in der Vergangenheit nicht kannten.
Was genau meinen Sie mit dieser Transitionszeit?
Wir haben Krisen. Die Pandemie war eine Krise, der Krieg in der Ukraine ist auch eine. Aber die Welt, Europa und Luxemburg gehen auch durch eine Transition. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Energie- und Klimapolitik. Vieles ist dabei, sich zu verändern. Und man kann nicht alles als Krise bezeichnen. Da haben wir versucht, uns so aufzustellen, dass die demokratische Dimension dabei nicht abhandenkommt. Was die Hauptrolle eines Parlaments sein sollte, meiner Meinung nach.
Die Qualität eines Parlaments kann man nicht an der Explosion von Zahlen messen
Die Zahl der Sitzungsstunden des Parlaments ist im Vergleich zur Legislaturperiode 2013-2018 um die Hälfte angewachsen. Komplexere Welt, mehr Debatten?
Ja, ganz klar. Unser Ziel ist eigentlich, eher weniger als mehr Plenarsitzungen zu haben. Die Qualität eines Parlaments kann man nicht an der Explosion von Zahlen messen. Der Hauptgrund, warum es so viele Sitzungen gab, liegt ganz sicher an der Covid-Zeit. Damals war es für das Parlament wichtig, da zu sein, weiterzuarbeiten, operationell zu sein. Uns war von Anfang an klar, dass in so einer außergewöhnlichen Zeit, in der die Regierung auch außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen muss, das Parlament eingebunden sein und auch präsent sein muss.
Das Gesetz zu den Covid-Maßnahmen musste 32-mal durch das Parlament. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Das war eine außerordentlich intensive Zeit, auf die wir stolz sind. Ich glaube, das Wort kann man bei aller Bescheidenheit gebrauchen. Nicht wegen der Rolle des Parlaments, sondern weil es uns gelungen ist, in Luxemburg diese sehr einschneidenden Maßnahmen, die nötig waren, mit einer Debattenkultur zu begleiten. Dass sich jeder ausdrücken und gehört werden konnte. Abgeordnete, die nicht einverstanden waren. Aber auch Bürger, durch unser Petitionsinstrument. Dass wir die Gesetze dadurch verfeinern konnten. Oder übertriebene Maßnahmen nicht durchkamen oder schnell geändert werden konnten. Eine permanente demokratische Kontrolle über diese einschneidenden Maßnahmen durch eine kritische institutionelle Auseinandersetzung. Dass diese demokratische Kultur wahrgenommen wurde. Stolz ist vielleicht trotzdem das falsche Wort. Es war schön zu sehen, dass dieser demokratische Reflex so stark war. Ich will es so ausdrücken.
Hängt damit auch die Verdopplung der parlamentarischen Anfragen in der vergangenen Legislaturperiode zusammen? Gab es mehr Diskussionsbedarf zwischen den Abgeordneten und der Regierung?
Das ist sicherlich ein Faktor, der erklärt, warum die parlamentarischen Anfragen in dieser Zeit so hoch waren. Wir haben überdurchschnittlich viele Fragen bekommen von den Parlamentariern. Durch diese Krisen, durch Covid, durch den russischen Angriffskrieg wurde die Kontrollfunktion des Parlaments umso wichtiger. Und von den Abgeordneten auch wahrgenommen. Es gibt aber auch andere Variablen. Mit den Piraten saß in dieser Legislatur eine Partei mehr im Parlament, die auch sehr aktiv von diesem Instrument Gebrauch machte. Außerdem war die größte Partei im Parlament, die CSV, in der Opposition. Und die haben natürlich Firepower. Das hat man auch gespürt.
Niemand hat mehr von mir erwartet, die Dinge so zu machen wie früher. Weil das nicht mehr möglich war.
Sie haben den Job als Generalsekretär im Februar 2020 angetreten. Einen Monat später rief Premierminister Bettel den Ausnahmezustand aus. Wie lief dieser Einstieg?
Paradoxerweise hat mir das sehr viel Druck genommen. Niemand hat mehr von mir erwartet, die Dinge so zu machen wie früher. Weil das nicht mehr möglich war. So konnte ich die Ziele, die ich mir schon vorher gesetzt hatte, schneller umsetzen. Auch, weil sie durch die Krise unabdingbar geworden waren: eine Entbürokratisierung und Digitalisierung der Verwaltung. Eine andere Aufstellung, wie die mittlerweile 162 Mitarbeiter hier funktionieren. Mehr Delegation von Verantwortung in die Belegschaft rein. Weniger Mikromanagement. Eine Krise verlangt eine agile Verwaltung. Und wir konnten das auch nach Covid beibehalten. Wenn es schnell gehen muss, dann funktionieren wir. Bürokratische Schwerfälligkeiten, die man in jeder Verwaltung findet, werden dann beiseitegelegt. Das ist mir sehr wichtig.

Gibt es Momente aus den vergangenen Jahren, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
Während der Covid-Zeit gab es drei Momente. Der erste war der Ausnahmezustand. Wir haben drei Monate weiter funktioniert, waren vom Krisenmanagement aber eigentlich ausgeschlossen. Der Premierminister, die Gesundheitsministerin und andere Minister der Regierung haben jede Woche, bevor die Presse informiert wurde, das Büro und die Präsidentenkonferenz über die Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Das hatte eine gewisse Dramatik, weil das ein sehr kleiner Kreis war. Der zweite Moment in der Pandemie war, dass wir anfangs unsere Sitzungen über sechs Plenarsäle verteilen mussten, während wir gleichzeitig auf der Suche nach einem anderen Ort waren. Im April sind wir dann in den „Cercle municipal“ auf der place d’Armes gezogen und 18 Monate da geblieben. Das war sehr speziell.
Hat das die Arbeit verändert?
Nein, eigentlich nicht. Das Gefühl war anders, aber die Art, wie die Debatten abgelaufen sind, wie das Parlament seine Funktion wahrgenommen hat, da gab es keinen Unterschied.
In der Dieschbourg-Affäre konnte man sehen, wie explosiv Politik sein kann, wenn der Rahmen noch nicht definiert ist
Fehlt noch Ihr dritter Moment.
Dass es politisch schön zu sehen war, dass diese Debattenkultur sich so stark entfalten konnte. Dass sich unsere Demokratie nicht nur bestätigt hat, sondern dass sie sich dadurch noch vertieft hat. Es gab noch ein anderes Thema, die Carole-Dieschbourg-Affäre. In einem Parlament ist man ganz prozedural. Wir haben viele Regeln. Je demokratischer man sein will, desto mehr Regeln hat man. Damit jeder zur Sprache kommen kann, zum Beispiel. Es ist so wichtig, in einem Parlament klare Regeln zu haben. In der Dieschbourg-Affäre waren wir in einer Situation, in der es drei Wochen lang keine klaren Regeln gab. Wir mussten uns die Regeln geben. Da konnte man sehen, wie explosiv Politik sein kann, wenn der Rahmen noch nicht definiert ist.
Der Rücktritt der Ministerin Dieschbourg hat diese juristische Unklarheit ausgelöst?
Es war so, dass die alte Verfassung damals sagte: Nur die Abgeordnetenkammer kann eine Anklage gegen einen Minister machen, nicht die Staatsanwaltschaft. Also hat die Staatsanwaltschaft die Sache ans Parlament weitergeben, als sie bei ihren Ermittlungen bei der Ministerin angekommen war. Das hatten wir nicht erwartet. Wir wollten die rechtsstaatlichen Prinzipien hochhalten und keine Fehler machen. Da wir da keine Regeln hatten, mussten die definiert werden. Ein Gesetz musste ausgearbeitet werden. Das hat ein Jahr gedauert.
Sie haben die Verfassungsänderung angesprochen. Auch keine alltägliche Sache für ein Parlament.
Das war ganz sicher auch ein sehr großer Moment für das Parlament. Weil wir eine Zweidrittelmehrheit brauchen für eine Verfassungsänderung, war es sehr schön zu sehen, wie gut ein Parlament funktionieren kann, wenn große Teile der Opposition mit eingebunden sind. Über die Modernisierung der Verfassung und den Inhalt der Verfassung hinaus ist die Art, wie das gemacht wurde, für mich aus der Innenperspektive sehr schön zu sehen. Dass man nicht immer diese tiefen Gräben zwischen Mehrheit und Opposition hat. Dass man auch anders arbeiten kann.
So friedlich lief es aber in der gesamten Legislaturperiode nicht immer ab zwischen der Mehrheit und der Opposition? Ich denke da zum Beispiel an die Abstimmung zum CETA-Abkommen, bei der die CSV den Saal verließ.
Das war im Cercle Cité, mitten in der Pandemie, im Ausnahmezustand. Wenn ich mich richtig erinnere, ging es darum, dass man ruhig hätte warten können, bis der Ausnahmezustand vorbei wäre, damit keine Missverständnisse entstehen. Die Opposition ist zweimal aus dem Saal gegangen in dieser Legislatur, um einen Punkt zu machen. Das andere Mal war 2019 (damals hatte sich die Regierung geweigert, sich zu den Polizeidatenbanken zu äußern, Anm. d.Red.). Im Allgemeinen wurde eine sehr starke Oppositionsarbeit gemacht in der gesamten Legislatur. Das ist für eine Demokratie, die diesen Namen verdient hat, ein sehr positives Zeichen.
Meine Kollegen haben mich noch auf einen anderen Vorfall im Parlament aufmerksam gemacht: Fred Keup (ADR), der Franz Fayot (LSAP) als „Topert“, als Idiot, beschimpfte, nachdem dieser ihn zuvor als „rechtsextrem“ bezeichnet hatte.
Es kommt in einem Parlament vor, dass die Debatten etwas hochkochen und dass persönliche Aussagen gemacht werden. Das ist nicht im Sinn der Sache, aber das sind Momente, die – ich würde sogar sagen – dazugehören. Wichtig ist, dass so etwas im Nachhinein verarbeitet wird. Auch von uns im Parlament. Das steht dann in der Präsidentenversammlung auf der Tagesordnung. Da wird in aller Ruhe darüber diskutiert. Unsere Schlussfolgerung: Die Debatte über die politische Positionierung einer Partei müssen die Abgeordneten unter sich ausmachen, der Präsident muss da nicht eingreifen.

Ist der Fall des Mittelfingers, den Myriam Cecchetti („déi Lénk“) Dan Kersch (LSAP) zeigte, auch vor diesem Gremium gelandet?
Genau. Die Problematik war aber ganz anders gelagert. Das war eine spontane Reaktion aufgrund eines gegenseitigen Hochschaukelns. Die Abgeordnete Cecchetti hat das eher im Affekt gemacht und es gar nicht gemerkt, als sie von der Bühne gegangen ist. Der Präsident und ich haben das auch nicht gesehen, weil wir auf der anderen Seite von Cecchetti saßen. Zehn Minuten später war es dann auf Facebook und Myriam Cecchetti ist zu mir gekommen und hat gefragt: Laurent, habe ich das wirklich gemacht? Sie hat sich gleich in derselben Sitzung noch entschuldigt. Bei uns im Parlament war das dann kein größeres Thema mehr.
Ein Parlament ist ein sehr komplexes Tier
Am 8. Oktober sind Wahlen. Die aktuelle Legislaturperiode geht noch bis zum 24. Oktober. Was machen Sie und Ihre Mitarbeiter bis dahin?
Wir bereiten uns jetzt schon intensiv auf die neue Legislatur vor. Das Onboarding und der Empfang der neuen Abgeordneten. Im Schnitt sind das immer so 20 Prozent. Ein Parlament ist ein sehr komplexes Tier. Es ist für neue Abgeordnete sehr schwierig, sich zurechtzufinden. Das liegt dann in der Verantwortung der Verwaltung des Parlaments, die nötigen Informationen zu liefern: Wie funktionieren die Kommissionen? Wie die Plenarsitzungen? Wir haben sehr viele Digitalisierungsprojekte. Und wir haben eine ganz neue Verfassung, die jetzt auch umgesetzt werden muss, mit ganz vielen neuen Regeln, die auch das Parlament betreffen.
Herr Scheeck, zum Schluss würde ich Sie noch einmal um ein, zwei Sätze bitten. Diesmal nicht über die Vergangenheit, sondern über Ihre Hoffnungen für die nächste Legislaturperiode.
Erstens, dass wir auch wieder Momente erleben, in etwaigen Krisensituationen, in denen sich Opposition und Mehrheit zusammenschließen, wenn es um die Zukunft des Landes geht. Dass die Debattenkultur, die sich in dieser Legislatur vertieft hat, weiter so lebendig bleibt. Dass der Pluralismus, der in Luxemburg gelebt wird, sich auch im Parlament widerspiegelt. Und meine vierte Hoffnung: Wir haben in dieser Legislatur sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Parlament offen ist. Es hat nicht nur eine legislative Funktion und eine Kontrollfunktion, es steht auch mit einem festen Fuß in der Gesellschaft. Es liegt uns sehr am Herzen, diese Bürgernähe, diese offenen Türen, diese Transparenz auch in Zukunft zu vermitteln.

 De Maart
De Maart






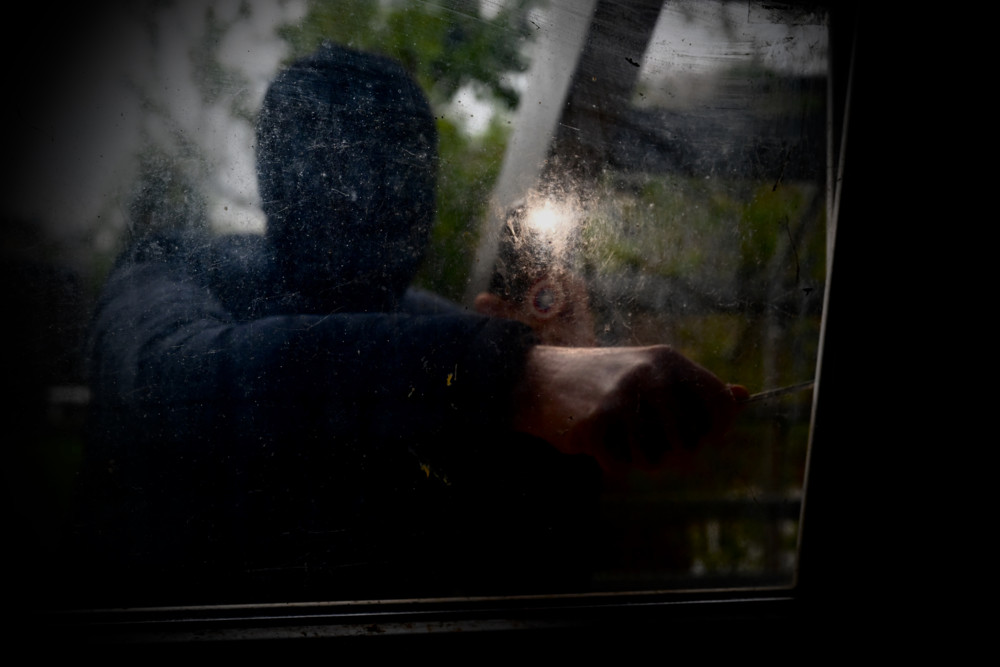
Guten Tag Herr Scheek,
seit 1933 ist die parlamentarische Demokratie in Luxemburg auf einem Transparenzniveau, das mit Wohlfühlworten nicht zu beschreiben ist. Da aber in der luxemburgischen Demokratie keine anderen Worte als aus der Kategorie "alles ist gut" Gehör finden, werde ich wohl als implodierter Wutbürger sterben. Ich hoffe, dass ich dann von der "Wohlfühlwelt" erlöst bin.
MfG
Robert Hottua