Wo und unter welchen Voraussetzungen in der Öffentlichkeit Überwachungskameras aufgehängt werden dürfen, regelt in Luxemburg seit 2021 das sogenannte „Visupol-Gesetz“. Die grünen Minister François Bausch und Henri Kox hatten den Text einst eingebracht und durch die Institutionen begleitet. Darin wurde erstmals ein gesetzlicher Rahmen für die öffentlichen Videoüberwachung definiert: mögliche Orte, an denen die Polizei Kameras installieren darf, aber auch verschiedene Bedingungen, wie ein Nachweis der Notwendigkeit und eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit durch Gutachten von verschiedenen Instanzen wie der Staatsanwaltschaft und dem betreffenden Gemeinderat.
CSV-Innenminister Léon Gloden ist nun dabei, dieses Gesetz zu reformieren. Im April hatte er der zuständigen Kommission einen ersten Vorschlag vorgelegt – mit dem Ziel, die Abläufe für die Genehmigungen von Kamerasystemen zu verkürzen. Gloden wünscht sich schnellere und einfachere Prozeduren. „Simplification administrative“, das soll auch bei der Videoüberwachung gelten. Der Gesetzesentwurf sieht einige Neuerungen vor: Eine davon ist das Initiativrecht für den Bürgermeister einer Gemeinde, der in Zukunft bei der Polizei eine Analyse beantragen können soll, ob an bestimmten Orten eine Videoüberwachung möglich sei. Der potenziell weitestreichende Änderungswunsch betrifft jedoch die Orte selbst: Im ursprünglichen Text werden Verkehrsknotenpunkte („pôles d’échange“) und öffentliche Parks automatisch als gefährliche Orte mit besonderem Risiko für Straftaten definiert. Soll heißen: Wenn dort in Zukunft Kameras installiert werden sollen, muss nicht mehr vorab nachgewiesen werden, dass es keine anderen Mittel zur Verhinderung und Verfolgung von Straftaten gibt als die Überwachung mit einer Kamera – ein schnelleres Ausnahmeverfahren.
Keine automatischen Verlängerungen
Zu dieser Ausnahme wird es nun nicht kommen – zumindest nicht für öffentliche Parks. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Staatsrat als erste Institution ein Gutachten zum geplanten Gesetzesentwurf und kritisierte darin die fehlenden Definitionen, was genau unter öffentlichen Parks und „pôles d’échange“ als Orte von erhöhtem Risiko für Straftaten zu verstehen sei. Der Text könne „so ausgelegt werden, dass er auf jeden Raum abzielt, der die Intermodalität zwischen verschiedenen Personenbeförderungsarten erleichtern soll, unabhängig von seiner Größe, seiner Frequentierung oder seiner geografischen Lage“, heißt es im Gutachten. Dasselbe gelte für den Begriff „öffentliche Parks“, der ohne klare Definition auf alle „Stadtparkzonen“ abzielen könnte. „Das Fehlen einer Definition bedeutet, dass die Exekutive die Befugnis hat, diese Begriffe nach Belieben auszulegen.“
Nach der Kritik des Staatsrats hat der Minister nachgebessert. Am Mittwoch diskutierte die zuständige Chamber-Kommission über die Änderungen. Der Begriff „öffentliche Parks“ sei nun aus dem Entwurf gestrichen, sagt Berichterstatterin Stéphanie Weydert (CSV) nach der Sitzung. Ein Ausnahmeverfahren ohne Beleg der Ausschöpfung aller anderen Mittel wird es also für öffentliche Parks nicht geben. „Man kann immer noch auf dem normalen Weg argumentieren, dass man dort eine Kamera braucht“, so Weydert.
Was die Verkehrsknotenpunkte angeht, so bekommt der Gesetzesentwurf nun eine eindeutige Definition. Sie stammt aus dem (ebenfalls noch nicht gestimmten) Gesetzesprojekt 8335 zur Sicherheit und Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr. Ein „pôle d’échange“ wird damit einer „gare de transbordement“ gleichgestellt, definiert als „lieu ou espace d’articulation des réseaux de transports publics qui vise à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs.“ Die „gare périphérique“ auf Howald, so die Abgeordnete Weydert, sei ein Beispiel für solch einen Knotenpunkt. Ob diese Definition den Anforderungen des Staatsrats hinsichtlich einer Festlegung bei Größe, Frequentierung oder geografischer Lage tatsächlich gerecht wird, bleibt abzuwarten.
Die zweite wichtige Änderung im Gesetzestext geht ebenfalls auf eine Kritik des Staatsrats zurück. Innenminister Gloden hatte die Genehmigungsdauer der Videoüberwachung von drei auf fünf Jahre erhöht. Damit ist der Staatsrat einverstanden – nicht jedoch mit der Möglichkeit einer vereinfachten Verlängerung nach Ablauf dieser Frist. Im neuen Gesetz hätte bei einer Verlängerung der Überwachung auf eine erneute Folgenabschätzung ebenso verzichtet werden können wie auf eine neue Konsultation. Aufgrund der starken Einschnitte in die Freiheitsrechte bei öffentlicher Videoüberwachung spricht sich der Staatsrat gegen diesen beschleunigten Erneuerungsmechanismus aus. Der Passus wird nun aus dem Gesetz gestrichen. „Da bleiben wir einfach bei der normalen Prozedur, um eine Kamera aufzuhängen – auch bei der Erneuerung“, sagt Weydert.
Insgesamt begrüßt die CSV-Abgeordnete das neue Gesetz: „Es kann nie ein Allheilmittel sein, aber es kann der Polizei helfen, ihre Missionen sinnvoller und effizienter zu erfüllen.“ Der neue Text wird nun noch einmal dem Staatsrat vorgelegt. Auch die Menschenrechtskommission hat ein Gutachten angekündigt.

 De Maart
De Maart







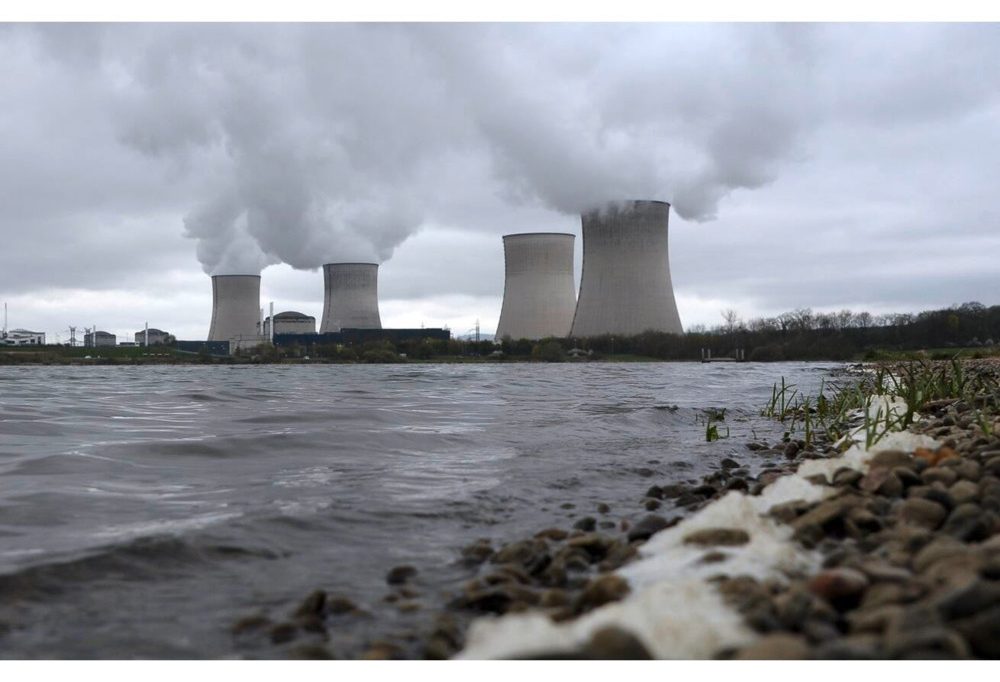

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können