Die Preisunterschiede dies- und jenseits der Grenze sind bisweilen horrend: Eine im Mai in München für 1,79 Euro angebotene Packung Cremissimo-Eis des Unilever-Konzerns kostete in Österreich mehr als dreimal so viel. Ein Liter Coca-Cola haben Testkäufer der Tiroler Arbeiterkammer in München für 65 Cent, in Innsbruck für 1,49 Euro gekauft. Ein durchschnittlicher Warenkorb mit 63 Artikeln kostet in der Alpenrepublik 26 Prozent mehr als beim großen Nachbarn.
Das Problem ist nicht neu und beschäftigt auch andere Länder in der EU. Der von Eurostat ermittelte harmonisierte Konsumentenpreisindex bei unverarbeiteten Lebensmitteln lag im März/April dieses Jahres für Österreich bei 156, für Luxemburg bei 138 Punkten. Bei saisonalen Produkten ist der Länder-Aufschlag mit jeweils rund 130 Punkten in etwa gleich, Luxemburg liegt da sogar knapp über Österreich.
Binnenmarktfarce
Möglich sind derartige, die Grundidee des europäischen Binnenmarktes ad absurdum führende Preisunterschiede, weil manche Konzerne die Macht des Marktes mit sogenannten territorialen Lieferbeschränkungen (territorial supply constraints, TSC) außer Kraft setzen. In der Praxis läuft das so: Einem deutschen Zwischenhändler, der Schokolade nach Österreich und Belgien weiterverkaufen wollte, wurde dies vom Mondelez-Konzern untersagt. In diesem Fall konnte die EU-Kommission auf das Kartellrecht zurückgreifen und Mondelez im vergangenen Jahr eine Strafe von knapp 338 Millionen Euro aufbrummen. Das sind Peanuts im Vergleich zum den Konsumenten zugefügten Schaden. Dieser belief sich einer 2020 veröffentlichten Studie der EU-Kommission zufolge auf jährlich 14 Milliarden Euro. Fünf teils hochinflationäre Jahre später dürfte die Abzocke ein entsprechend größeres Ausmaß angenommen haben.
Doch nicht immer greifen Kartell- und Wettbewerbsrecht. Deshalb starteten im Mai 2024 acht kleine EU-Staaten, darunter Luxemburg, im EU-Wettbewerbsrat eine Initiative gegen die TSC. Nicht dabei: das von der Konsumentenabzocke besonders betroffene Österreich. Das war wohl kein Zufall. Denn noch im vergangenen Juni wurde in der zuständigen Ratsarbeitsgruppe protokolliert, dass die vom Wiener Wirtschaftsministerium entsandten österreichischen Vertreter die Diskussion über die TSC zwar begrüßten, aber zur Zurückhaltung mahnten. Die Erklärung dafür: Einige Lebensmittelkonzerne produzieren in Österreich und kaufen dort Agrarprodukte. In Bludenz (Vorarlberg) etwa spuckt das dortige Mondelez-Werk täglich eine Million Tafeln Milka-Schokolade aus. Eine Abschaffung der auch von der EU-Kommission angestrebten Lieferbeschränkungen könnte für Österreich Produktionsverlagerungen und damit Arbeitsplatz- bzw. bäuerliche Einkommensverluste bedeuten.
Volksseele kocht
Das Sitzungsprotokoll wurde gerade zu dem Zeitpunkt bekannt, als in Österreich die Volksseele wegen der wieder steigenden Inflation hochkochte. Mittlerweile liegt sie mit 4,1 Prozent doppelt so hoch wie im EU-Schnitt – eine Folge der Füllhornpolitik vergangener Jahre, in denen die ÖVP im Bund mit den Grünen zwecks Vermeidung ideologisch verpönter Eingriffe in die Preisgestaltungsfreiheit lieber mit milliardenschweren Ausgleichszahlungen das Land in eine Doppelmühle steuerte: Inflation und Budgetdefizit galoppieren gleichermaßen davon, während Mittel zur Belebung der lahmsten Konjunktur in der Euro-Zone fehlen.
Während sich ein nationaler Proteststurm gegen die sich scheinbar mehr der Industrie und den Bauern verpflichtet fühlende ÖVP zusammenbraute und auch Ärger mit den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS drohte, vollzogen die Christdemokraten einen Schwenk. Bundeskanzler Christian Stocker bekundete in allen Sommer-Interviews, er sei „nicht mehr bereit, den Österreich-Aufschlag zu akzeptieren“. Dieser solle durch ein Verbot verschwinden, so der ÖVP-Chef.
Ein solches soll dazu beitragen, Stockers soeben erfundene „2-1-0-Formel“ für das kommende Jahr zu verwirklichen, wobei die Zwei für das Inflationsziel, die Eins für das im kommenden Jahr angestrebte Wirtschaftswachstum und die Null für das Maß der Toleranz gegenüber Demokratiegefährdern steht. Zur Halbierung der Teuerung wird jedoch die EU kaum binnen Jahresfrist mit dem plötzlich auch von Österreich herbeigesehnten Lieferbeschränkungsverbot beitragen können. Denn das Ziel der Kommission ist es, ein entsprechendes Gesetz bis Ende 2026 zu erarbeiten. Bis dahin werden die Lobbyisten der Lebensmittelkonzerne nicht untätig bleiben. Aber immerhin haben sie es jetzt mit neun statt nur acht durch Preisaufschläge abgezockte EU-Ländern zu tun. Es sei denn, in Wien bekommen nach den sommerlichen Preisproteststürmen die Argar- und Industrielobby doch wieder Oberwasser.

 De Maart
De Maart

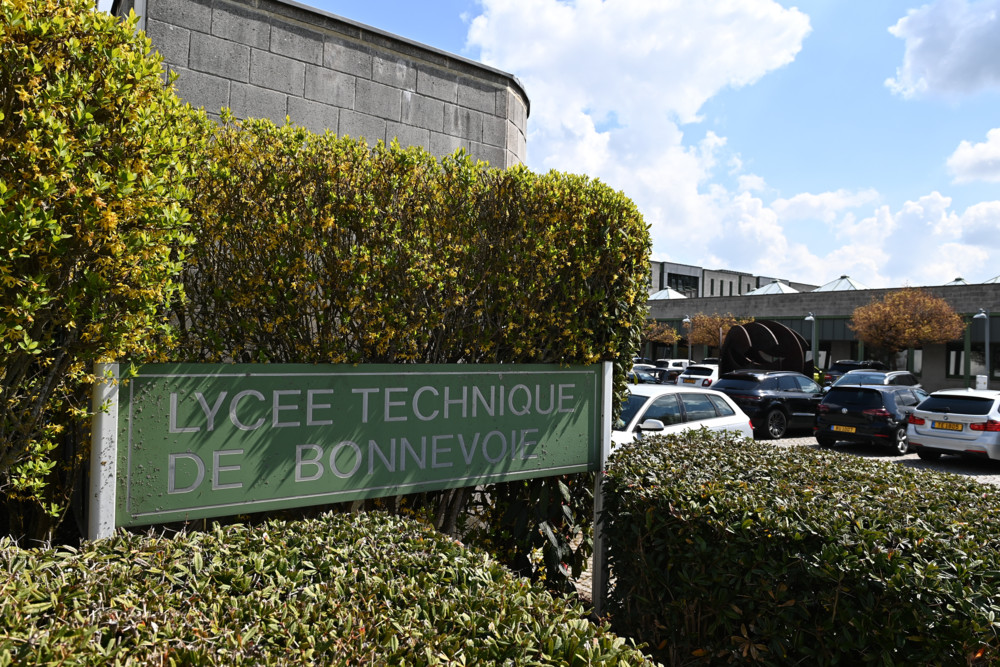





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können