Zuerst ist die Herangehensweise von Nuno Cardoso, der im zentral-portugiesischen Canas de Senhorim geborene und aufgewachsene Regisseur, der in Coimbra studierte und dort mit dem Theater begann, eine persönliche: Wie sein Vater, der während des Kolonialkrieges vier Jahre in Guinea-Bissau war und dem er die Inszenierung gewidmet hat, sind die Protagonisten von „Fado Alexandrino“ ehemalige Kämpfer, die von ihren Geschichten und Gedanken vor, während und nach der Nelkenrevolution vom 25. April 1974 erzählen.

„Ich hielt es für absolut notwendig (…) weil es ein früherer Wunsch war, und weil die Erfahrung, die mein Vater im Kolonialkrieg gemacht hat, einen großen Teil seiner Zeit und seiner Überlegungen begleitet“, sagt Cardoso über seine Bühnenadaption. Er hält das 1983 erschienene Buch für eines der wichtigsten Werke von António Lobo Antunes und eines der größten der portugiesischen Literatur. Gelesen hat es der künstlerische Leiter des Nationaltheaters São João in Porto zum ersten Mal in den 90er Jahren. Aber erst bei einer erneuten Lektüre vor etwa zehn Jahren beschloss er, den 700-seitigen Roman für das Theater zu adaptieren.
Für Nuno Cardoso sind die Kolonialkriege noch immer präsent, auch und vor allem, weil es kaum oder keine Diskussion darüber gebe: „Ich denke, es war ein heißes Eisen, auf eine sehr gewalttätige Weise und für immer.“ Der Regisseur betont, dass der Text eine „außergewöhnliche“ Eigenschaft habe, nämlich dass er in einer „theatralischen Nullsituation“ existiere. „Es ist ein Essen; es sind Menschen, die an einem Tisch sitzen. Das ist die Nullsituation der theatralen Situation“, erklärt er.
In „Fado Alexandrino“ treffen fünf Soldaten, die zehn Jahre zuvor aus dem Kolonialkrieg zurückgekehrt sind, sich zu einem Abendessen wie zu einem letzten Abendmahl. Wie so oft im Werk von Lobo Antunes werden auch in „Fado Alexandrino“ verschiedene Zeitebenen miteinander verbunden: die Zeit des Estado Novo, der Kolonialkrieg in Mosambik, die Nelkenrevolution von 1974 und schließlich die Zeit nach der Revolution.
B-Seiten des Lebens
„Fado Alexandrino“ sei eine Allegorie der portugiesischen Geschichte, eine Odyssee der Seele des Landes, findet Cardoso – und ein Schlüssel zum Verständnis seiner Kultur. „Das Buch ist nicht sanft“, sagt er über das Werk, das er mit Fernando Villas-Boas adaptierte und dramatisierte. „Ich bin mir bewusst, dass es kein Buch zum Feiern ist, das war ich schon immer. (…) Wir haben 50 Jahre lang über den Kolonialkrieg geschwiegen und über die Auswirkungen, die er auf die Menschen hatte, die dabei waren. Diese Menschen haben unsere Demokratie aufgebaut, und viele von ihnen fühlen sich jetzt im Stich gelassen. Genauso wie wir uns dem Akt der Aggression, der der Kolonialkrieg war, nicht gestellt haben.“
Wir haben 50 Jahre lang über den Kolonialkrieg geschwiegen und über die Auswirkungen, die er auf die Menschen hatte, die dabei waren
Er habe den Eindruck, dass Werke wie „Fado Alexandrino“ ähnlich wie Louis-Ferdinand Célines „Reise ans Ende der Nacht“ (1932) die versteckte Geschichte eines Landes zeigen, in dem einen Fall die portugiesische, in dem anderen die französische. Diese Romane zeigen die Geschichte nicht in Schwarz-Weiß, sondern in ihren einzelnen Grautönen. Es seien, wie Cardoso sagt, wie bei einer Schallplatte, „die B-Seiten des Lebens“. Oft sage man, dass Portugal ein Land der Poeten sei. Dabei sei es genauso gut ein Land der Romanciers, wie etwa Lobo Antunes oder José Saramago (1922-2010), mit dem er sich auch schon befasst hat. Dagegen habe das portugiesische Theater keine große Tradition. Trotzdem sei es heute sehr lebendig und interessant.
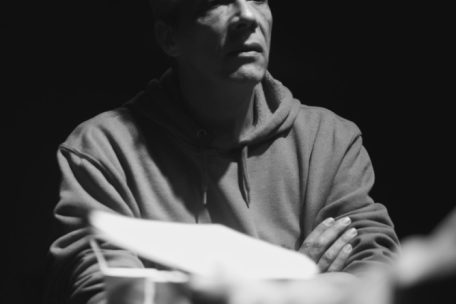
Antunes’ Werk
Doch zurück zu Lobo Antunes: Jener hat die Arbeit an seinen Romanen einmal „Schreiben ohne Kondom“ genannt. Der langjährige Psychiater setzte sich jeden Tag hin und bildete eine um die andere seiner vielstimmigen Satzkaskaden, einen Bewusstseinsstrom verschiedener Personen und einen oft von Satz zu Satz erfolgenden Perspektivenwechsel. Manche Beschreibungen wiederholen sich. Verschiedene Stimmen ergeben einen polyphonen Chor, unterschiedliche Zeitebenen schieben sich übereinander. Es fehlt eine obere Autoreninstanz. Alles fließt wie in einem Fluss der Assoziationen, wie in einem „Stream of Consciousness“, jenem literarischen Verfahren, das erstmals William James verwendet und das Schriftsteller wie William Faulkner, James Joyce oder Alfred Döblin meisterlich praktizierten.
Lobo Antunes begibt sich auf die Reise ins Innere des Menschen und beschreibt ihn auf dem Weg seiner Auflösung. Seine Werke sind Protokolle des Niedergangs, in denen er Portugals einst strahlende Größe als Lügenkonstrukt entlarvt. Er beschreibt das Seelenleben seiner Protagonisten und seziert die Psyche von Tätern und Opfern, wie bereits in „Elefantengedächtnis“ oder in „Der Judaskuss“ (beide 1979). Der Kolonialkrieg in Angola und Mosambik wird dabei ein Synonym unsühnbarer Schuld. Er nimmt einen zentralen Platz in seinem Werk ein. Als „übler Ort am Rand der Wüste“ sei er weit genug entfernt, aber doch zugleich ganz in der Nähe. Einmal schreibt Lobo Antunes, das ideale Buch sei eines, „in dem alle Seiten Spiegel sind: Sie reflektieren mich und den Leser, bis keiner von uns mehr weiß, wer von uns beiden er ist.“ Weiter schreibt er: „Ich versuche, jeden von uns beiden zu machen, und wir kehren aus diesen Spiegeln zurück wie jemand, der aus der Höhle dessen, was war, zurückkehrt. Das ist die einzige Rettung, die ich kenne, und selbst wenn ich andere kennen würde, die einzige, die mich interessiert.“
Obsessiver Sprachrausch
Begibt man sich in das literarische Universum von Lobo Antunes, verfällt man seinem obsessiven Sprachrausch. Fernando Villas-Boas erinnert an Heiner Müllers Worte über die Kunst, einen Text zu adaptieren: „Zuerst esse ich ihn, erst dann fühle ich ihn.“ Die Verdauung des Romans von Lobo Antunes sei alles andere als einfach. „An einem Herbstnachmittag in Lissabon saß ich mit Nuno Cardoso zusammen, während er auf einem rasch dunkler werdenden Blatt Papier die tausend gekreuzten Linien und Bögen nachzeichnete, die geometrischen Blöcke des Mechanismus seiner Vision, die fast siebenhundertfünfzig Seiten des Romans auf die Bühne zu übertragen. Erste und zweite Ebene, Hierarchie der Szenen und Figuren, aufeinanderfolgende Umgebungen, usw.“ Nuno Cardoso habe es geschafft, ihn von den Vorzügen des Romans zu „überzeugen“. Dieser sei „ein mutiges Unterfangen“ gewesen.

Über die Protagonisten des Romans meint Villas-Boas: „Nach ihrer Rückkehr gibt es nichts und niemanden mehr, den sie kannten, und sie sind nicht wiederzuerkennen. Als der Soldat Abílio mit seiner Demobilisierungstasche in Lissabon ankommt, ärgert er sich über die veränderte Lage einer Bushaltestelle. Diese tiefe Ratlosigkeit wird bis zu seinem dummen Tod andauern: Es ist seine Unfähigkeit, wirklich in die Gegenwart zurückzukehren, die er nie erreichen wird. Weder er, noch der Fähnrich, noch der Funkoffizier, noch der Oberstleutnant, die Protagonisten dieser Flut menschlicher Irrtümer – und schließlich auch nicht der Kapitän, der auf sie alle hört und der nicht einmal ein Leben zu haben scheint, das er bedauert.“
Feiern oder Loben führen in der Regel nicht zu Diskussionen
„Fado Alexandrino“ gehört zu dem Komplex von Lobo Antunes‘ Romanen wie „Die Vögel kommen zurück“ (1981), „Der Reigen der Verdammten“ (1985) und „Die Rückkehr der Karavellen“ (1988). In „Der Archipel der Schlaflosigkeit“ (2008), in dem sich einmal mehr alles um jenes Thema dreht, das zusammen mit den Schrecken des Kolonialkrieges in Afrika das gesamte Werk des Autors prägt: um den Aufstieg und Niedergang Portugals, beschreibt er die archaische Gewalt, die über Generationen bis in die Gegenwart weiterwirkt, und wie die Strukturen des Regimes von António de Oliveira Salazar nach wie vor existierten. Portugal erlebte seither zwar eine tiefgreifende Modernisierung und trat 1986 der Europäischen Gemeinschaft bei. Aber die Verflechtung von Staat, Kirche und Großkapital sei geblieben. Sie lähme Portugal noch heute, weiß Lobo Antunes. In „Das Handbuch der Inquisitoren“ (1996), dem ersten von drei Bänden aus dem sogenannten Zyklus über die Gewalt, wird vom Zerfall einer Familie erzählt, und mit ihr der Niedergang einer Gesellschaft, der mit der Nelkenrevolution von 1974 nicht endete. Der Despotismus des Großvaters ist dabei als Metapher auf die Salazar-Diktatur zu verstehen, die in vielen Köpfen noch weiterlebt.

Die Nelkenrevolution beendete zwar den ständestaatlichen Estado Novo, aber nicht das Andenken an Salazar selbst: Der Diktator und Mussolini-Bewunderer ist bei vielen Portugiesen bis heute populär, nicht zuletzt wegen seiner Unbestechlichkeit und bescheidenen Lebensweise. In einer Sendung des portugiesischen Fernsehens wurde Salazar 2007 zum bedeutendsten Portugiesen aller Zeiten gewählt. Mit dem Aufstieg der rechtspopulistischen Partei Chega in den vergangenen Jahren zeigt sich, wie Nuno Cardoso anmerkt, dass Portugal nicht vor dem Vormarsch der Ultrarechten gefeit ist.
Die Diktatur lebt weiter
Der Estado Novo beziehungsweise der Salazarismus wird von Historikern nicht als Faschismus bezeichnet, sondern als konservativ-autoritäre Diktatur. Salazar setzte weniger auf Mobilisierung und Indoktrinierung als auf Unterdrückung und Ruhigstellung. Seine Nationale Union erlangte nie die Bedeutung anderer faschistischer Bewegungen. Um ein Staatsamt zu bekleiden, musste man nicht Mitglied in der Einheitspartei sein. Salazar unterschied zwischen Autoritarismus und Totalitarismus – Letzteren lehnte er ab. Trotzdem ist eine Diktatur eine Diktatur. Die paramilitärische Miliz Legião Portuguesa funktionierte wie die SA der Nazis, die Jugendorganisation Mocidade Portuguesa hatte ebenfalls faschistische Züge und die Hitlerjugend als Vorbild, und auf den Kapverdischen Inseln wurde das Konzentrationslager Tarrafel eingerichtet. Zwar propagierte Salazar nicht den Antisemitismus, doch verschleppte und ermordete die Geheimpolizei PIDE Regimegegner.
Lobo Antunes hat sich diese dunkle Vergangenheit seines Landes zum Lebensthema gemacht. Er beschreibt, wie die Strukturen des Salazar-Regimes lange Zeit noch Bestand hatten. Das virtuose Spiel mit der Sprache ließ ihn viele Jahre zu einem heißen Kandidaten auf den Literaturnobelpreis werden, aber vor Jahren musste er seinem Landsmann Saramago den Vortritt geben. Dieser schrieb stilistisch wesentlich konventioneller. Lobo Antunes erhielt 2007 den Camões-Preis, die höchste Auszeichnung der portugiesischsprachigen Literatur. Als er von der Anfrage hörte, die Rechte für die Inszenierung des Stücks mit Nuno Cardoso als Regisseur zu übertragen, meinte er wohl: „Soll er es doch tun!“
Zum Stück
Inszenierung, szenische Adaptierung und Dramaturgie: Nuno Cardoso; Musik: Pedro „Peixe“ Cardoso; Darsteller: Ana Brandão, António Afonso Parra, Joana Carvalho, Jorge Mota, Lisa Reis, Patrícia Queirós, Paulo Freixinho, Pedro Almendra, Pedro Frias, Telma Cardoso, Sérgio Sá Cunha und Roldy Harrys.
Vorstellungen im TNL: 18. Januar um 19.30 Uhr, 19. Januar um 17 Uhr

 De Maart
De Maart









Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können