Neun von 40 Litern Wein, die jährlich pro Kopf konsumiert werden, stammen aus Luxemburg. Dieser Anteil soll in Zukunft möglichst steigen, wie Landwirtschaftsministerin Martine Hansen (CSV) nach dem zweiten „Wäibaudësch“ gegenüber der Presse erklärte. „Iesst an drénkt lokal“, so der Appell der Ministerin. Die Regierung will die Winzer sowohl bei der Produktion als auch bei der Vermarktung unterstützen, unter anderem durch eine bessere Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen.
International gewinnen alkoholfreie und alkoholreduzierte Weine zunehmend an Bedeutung. In Luxemburg ist deren Produktion jedoch bislang wenig rentabel, da für die Reduktion des Alkoholgehalts oft Weinmischungen verwendet werden, die unter die Alkopopsteuer fallen. Diese Steuer wurde 2004 eingeführt, um den Konsum von bei Jugendlichen beliebten Mischgetränken durch eine Preiserhöhung zu senken. „Wir werden versuchen, das Gesetz so anzupassen, dass Weinmischungen künftig nicht mehr unter diese Steuer fallen“, kündigte Finanzminister Gilles Roth (CSV) an und stellte in Aussicht, dass die neue Regelung am 1. Januar 2026 in Kraft treten kann.
54 Betrieben wollen aufhören
Die Sorgen der Winzer betreffen jedoch nicht nur die Produktion alkoholarmer Weine. Ein zentrales Thema bleibt die Nachfolge und Weiterführung der Betriebe. Eine Studie des Weinbauinstituts unter 172 Betrieben hat ergeben, dass bei 61 Prozent der Winzer, die älter als 50 Jahre sind, die Nachfolge entweder nicht gesichert oder gar nicht vorgesehen ist. 54 Betriebe planen in den kommenden fünf bis sieben Jahren ihre Tätigkeit einzustellen. Ein Aktionsplan zur Förderung von Betriebsgründungen und -übernahmen soll bis Ende des Jahres vorliegen. Im September wird eine Initiative der EU-Kommission zum selben Thema erwartet, die in den Plan einfließen soll.
Ein sichtbares Resultat der ungelösten Nachfolgeproblematik ist die zunehmende Zahl brachliegender Rebflächen. Derzeit sind es rund 25 Hektar, laut Berechnungen des Landwirtschaftsministeriums könnten es in den nächsten Jahren bis zu 100 Hektar werden. Diese ungenutzten Flächen beeinträchtigen nicht nur das Landschaftsbild, sondern fördern auch die Ausbreitung von Rebenkrankheiten, die auf benachbarte Parzellen übergreifen können. Dies bedeutet mehr Pflanzenschutzaufwand, zusätzliche Arbeit und höhere Kosten für die Winzer. Eine neu geschaffene Rebflächenbörse soll helfen, das Brachland wieder in Bewirtschaftung zu bringen.
Gesundheitspauschale und Rodungspflicht
Bei den betroffenen Flächen handelt es sich vor allem um die Rebsorten Elbling und Rivaner. Die Regierung plant, die Beihilfen zur Umstellung der Rebsorten zu erhöhen, damit vermehrt marktfähige Sorten angebaut werden können. Bis ein neu gepflanzter Rebstock Ertrag bringt, vergehen allerdings vier bis fünf Jahre. Weitere Maßnahmen sind eine zweijährige Gesundheitspauschale zur Bekämpfung von Rebkrankheiten. Zudem wird geprüft, ob für Eigentümer, die ihre Parzellen vernachlässigen, eine Rodungspflicht eingeführt werden kann. Für Lagen, die sich nicht mehr für den Weinbau eignen, wird geprüft, ob sie für den Obstanbau genutzt werden können – begleitet von einer Umstellungsprämie.
Jeff Konsbrück, Vizepräsident der Privatwinzer und Präsident des „Fonds de solidarité viticole“, zeigte sich mit dem Verlauf der Gespräche zufrieden: „Man kommt voran“, sagte der Winzer. Beim ersten „Wäibaudësch“ im vergangenen Jahr stand vor allem die Beschäftigung von Saisonarbeitern im Fokus. „Das wurde deutlich einfacher“, so Konsbrück rückblickend. Weitere Anpassungen in diesem Bereich seien geplant, ergänzte Ministerin Hansen.

 De Maart
De Maart








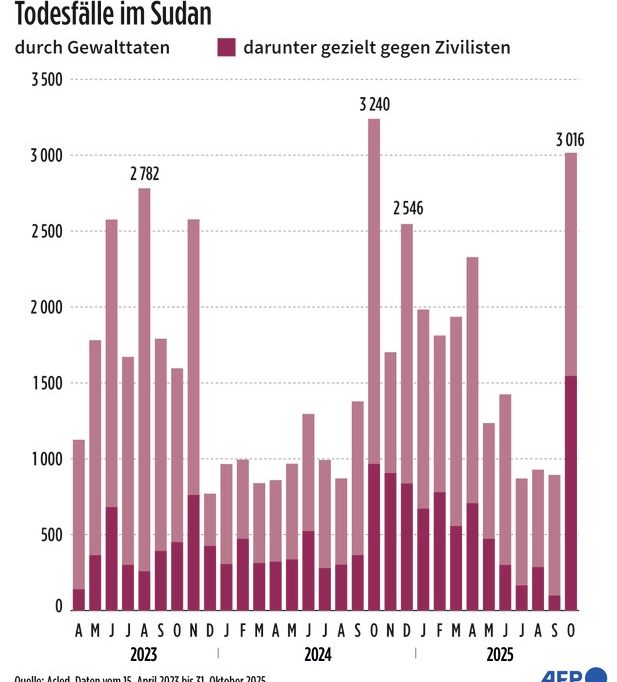
Wann sech zu Letzebuerg daat Spretzen ob wierklech een Minimum neidech beschraenkt, drenken ech och erem Letzebuerger Wein !
Spretzen fir dass d'Grass teschend den Reihen eweg stierft ass net di richteg Method !
Trinkt denn unsere Weinbauministerin auch in Restos diese
verteuerten Produkte.Weinkonsum wird unerträglicher.
Aufgrund der schädlichen Wirkung von Alkohol sollte die Produktion von alkoholhaltigen Produkten nicht mehr mit staatlichen Subventionen unterstützt werden. Da scheint die Obstproduktion doch echt eine interessante Alternative zu sein. Zudem könnten verschiedene Brachflächen sich für die Installation von Fotovoltaikanlagen eignen. Demnach ist der Rückgang des Weinanbaus grundsätzlich mal eine positive Nachicht.