Der Nebel über der verfallenen Fabrikhalle lichtet sich nur zögerlich. Weißer Reif hat in der klirrend kalten Nacht die Müllberge vor der Industrieruine am Ortsausgang der nordserbischen Provinzstadt Sombor überzogen. Bibbernd versuchen sich zwei übernächtigte Jugendliche an einem kokelnden Feuer zu wärmen. Sie seien aus Syrien und könnten kein Englisch, so ihre arabische Auskunft. Schulterzuckend weist ein bärtiger Jemenite mit bloßen Füßen in Badeschlappen auf einen Pfad, der durch das Gestrüpp zu einer heruntergekommen Lagerhalle führt: „Vielleicht findest du in dem Hangar jemanden, der mit dir sprechen kann.“
Der abgehärmte junge Mann mit dem müden Blick stellt sich als Hasan und Lehrer aus der syrischen Kurdenhochburg Qamishli vor. „Bei uns ist Krieg. Die Russen, die Türken und die Amis – alle mischen mit. Für uns gibt es dort kein Leben mehr“, erklärt der studierte Ökonom, warum er vor 90 Tagen seine Heimat in Richtung Deutschland verlassen hat. Er wolle ein „anderes, normales Leben“, sagt der schlaksige Kurde: „Aber der Weg ist schwer, sehr schwer.“
Größter Andrang seit 2015/2016
Den größten Andrang an den EU-Außengrenzen seit der Flüchtlingskrise von 2015/2016 vermeldet die EU-Grenzschutzbehörde Frontex: Fast die Hälfte der 308.000 in den ersten zehn Monate des Jahres registrierten illegalen Einreisen in die EU sei über die sogenannte Balkanroute erfolgt. Laut Angaben von Serbiens Flüchtlingskommissariat ist die Zahl der offiziell registrierten Flüchtlinge und Migranten beim EU-Anwärter in den ersten elf Monaten des Jahres um über 100 Prozent auf 116.312 gestiegen.
Den meisten von ihnen ist mittlerweile die Weiterreise geglückt. Neben den rund 5.200 Menschen, die sich derzeit offiziell in den völlig überfüllten Aufnahmelagern aufhalten, biwakieren unterschiedlichen Schätzungen zufolge im Grenzgebiet zu Ungarn weitere 1.000 bis 3.000 Menschen in Privatquartieren, verlassenen Höfen und Fabriken oder unter freiem Himmel.

Aufgebracht weist vor dem wilden Flüchtlingslager in Sombor ein junger Mann auf seinen eingegipsten Arm. Zwei Tage zuvor hätten ungarische Grenzpolizisten seinem Gefährten mit Knüppelschlägen den Arm gebrochen, übersetzt Hassan in holprigem Englisch. Ein anderer lässt stumm die schlecht vernarbtem Bisswunden an seinen Beinen sehen. „Die bulgarische Polizei hetzte Hunde auf uns und nahm unser Geld ab“, berichtet Hasan. Tagelang sei er mit seinen Schicksalsgenossen „ohne Nahrung“ durch die bulgarischen Berge nach Serbien gezogen: „Es war sehr kalt. Einer von uns ist in den Wäldern gestorben.“
Hart kritisiert wird Serbien wegen der teilweise bereits wieder kassierten Praxis, befreundete Staaten, die die Unabhängigkeit von Kosovo nicht anerkennen oder ihre Anerkennung zurückziehen, mit der visafreien Einreise zu belohnen. Doch es sind weniger die Folgen von Serbiens diplomatischen Windmühlenkampf gegen die Eigenstaatlichkeit der Ex-Provinz als die der Weltpolitik, die auf der Balkanroute für neuen Andrang sorgen.
Erdogans Druck auf die Syrer
70 Prozent der Flüchtlinge, die durch Serbien ziehen, stammten aus Afghanistan oder Syrien, sagt Milica Svabic von der Hilfsorganisation klikAktiv in Belgrad. Die vermehrten Bewegungen auf der Balkanroute seien einerseits mit den Spätfolgen der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, andererseits mit der veränderten Haltung der Türkei gegenüber den syrischen Flüchtlingen zu erklären: „Die Türkei hat angefangen, Flüchtlinge nach Syrien abzuschieben oder ihre Aufenthaltsgenehmigungen nicht mehr zu verlängern. Doch die Lage in Syrien ist für eine Rückkehr weiter nicht gut. Viele Syrer, die in den letzten fünf Jahren in der Türkei lebten, machen sich nun vermehrt nach Westen auf.“
Derzeit gelange der Großteil der Transitflüchtlinge wegen der verstärkten Überwachung der türkisch-griechischen Grenze von der Türkei über Bulgarien nach Serbien, so Svabic: „Von hier versuchen die meisten über Ungarn nach Westen zu kommen.“ Der Ausbau des Grenzzauns und die verstärkten Patrouillen an der Grenze zwischen Nordmazedonien und Serbien hätten derweil dazu geführt, dass die von Griechenland kommenden Flüchtlinge vermehrt einen „kleinen Umweg“ über Kosovo machen.
Neben neuen Zäunen oder verstärkten Patrouillen seien es jedoch vor allem die Schleppernetzwerke, die für die ständigen Änderungen der Balkanroute verantwortlich seien: „Letztendlich sind es die Schlepper, die den Routenverlauf bestimmen. Auf eigene Faust ist – anders als bis vor eineinhalb Jahren– in Serbien selbst auf Teilstrecken fast niemand mehr unterwegs.“
Mit den „besonders stark entwickelten“ Schleppernetzwerken in Serbien und Ungarn erklärt die Anwältin, dass die Hauptroute seit Sommer letzten Jahres erneut über das Land mit den höchsten Stacheldrahtzäunen und besonders eifrig prügelnden Grenzern verläuft: „Logisch ist die Passage über Ungarn keineswegs. Objektiv wäre es derzeit leichter, über Kroatien nach Westen zu gelangen, auch weil es dort kaum mehr zu gewalttätigen Pushbacks kommt. Aber die Schlepper führen die Leute gezielt an die ungarische Grenze.“

In Ungarn würden die Schlepper zum Weitertransport nicht unmittelbar an der Grenze, sondern in nahen Weilern oder Gehöften im Hinterland auf ihre Kundschaft warten: „Bis dorthin müssen sich die Leute allein durchkämpfen.“ Laut den Berichten von wieder abgeschobenen Flüchtlingen seien am Grenzzaun ungarische Grenzer, in einem „zweiten Gürtel bis zu zehn Kilometer im Landesinnern“ meist österreichische und deutsche Beamte stationiert, so Svabic: „Die Leute gelangen mit Leitern auf die Zäune, verletzten sich aber häufig beim Sprung nach unten. Mit gebrochenen Armen, Beinen oder Knöcheln werden sie von der ungarischen Polizei schon am Zaun gefasst und über die Grenze abgedrängt.“
Je stärker der Andrang, „desto größer die Gewalt“, so die Erfahrung von Svabic. Lange sei die bosnisch-kroatische Grenze „am brutalsten“ überwacht gewesen: „Als die Hauptroute 2020 zeitweise von Serbien über Rumänien nach Ungarn führte, traten auch die rumänischen Grenzer sehr gewalttätig auf und raubten die Leute aus.“ Nun intensiviere sich mit der gestiegenen Zahl der Grenzgänger erneut in Ungarn die Polizeigewalt. Im Gegensatz zu den ungarischen seien die dort eingesetzten Auslandsbeamten „normalerweise nicht gewalttätig“: „Wenn sie die Flüchtlinge aufgreifen, übergeben sie die Leute den ungarischen Kollegen, die sie über die Grenze nach Serbien abdrängen.“
Missmutig den Kopf schüttelnd beäugt der grauhaarige Slobodan vor seinem Haus in Sombor, wie übermüdete Rucksackträger aus dem nahen Wäldchen zu dem hinter seinem Anwesen gelegenen Auffangzentrum trotten. „Anfangs waren hier nur Familien untergebracht und gab es keinerlei Probleme“, berichtet der Karosseriemechaniker: „Die Kinder spielten auf dem Spielplatz. Und wir schenkten ihnen Bonbons.“
Doch seit vier Jahren sei sein Leben „zur Hölle“ geworden, klagt der sehnige Serbe: „Immer mehr Migranten kommen und gehen, Tag und Nacht. Der ganze Wald ist zur Müllkippe geworden. Sie fällen selbst Eichen für ihre Lagerfeuer.“ Seit der Sperrung der Zufahrtsstraße habe wenigstens die ständige An- und Abfahrt der Taxis geendet. Doch in der Nacht habe er auch schon Schüsse gehört: „Es ist nicht auszuhalten. Und wenn man die Polizei anruft, stellt die sich ahnungslos. Die sahnen selbst ab – und drücken bei Straßenkontrollen in den Dörfern für 20 Euro beide Augen zu, wenn die Autos mit den Leuten an die Grenze fahren.“
Schießereien unter Schleppern
Wiederholte Schießereien rivalisierender Schlepper-Clans haben in den Wäldern des Grenzlands nicht nur die Anwohner, sondern auch die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Für das TV inszenierte Polizei-Razzien und Massenhaftungen der Grenzgänger haben meist nur kurzen oder keinerlei Effekt. Niemand von ihnen will in Serbien bleiben: Selbst wenn aufgegriffene Flüchtlinge in abgelegene Lager in Südserbien deportiert werden, reisen sie umgehend wieder nach Norden – und versuchen erneut die Passage über Ungarns Stacheldrahtgrenze.
Bei den Syrern sind oft kleine Kinder von zwölf Jahren und jünger allein unterwegs
Vor allem alleinreisende Kinder und Minderjährige seien auf der Balkanroute „sehr starker Ausbeutung und Gewalt“ ausgesetzt, berichtet Tanja Ristic von der Kinderhilfsorganisation „Save the children“ in Belgrad. Sexuelle Gewalt sei für die Schlepper „auch eine Art, die Kinder zu kontrollieren“. Im Gegenzug für Hilfsdienste beim Menschenschmuggel oder beim Rekrutieren neuer Kunden erhielten mittellose Minderjährige das „oft nicht eingelöste Versprechen“ einer schnelleren Passage nach Westen. Gleichzeitig würden sie an den Grenzen auch vonseiten der Polizei Gewalt erfahren und hätten daher „keinerlei Vertrauen in staatliche Institutionen“: „Kinder, die ohne Familien reisen, haben niemanden, auf den sie sich stützen können – und stützen sich daher auf die Schlepper.“
Bei den Jugendlichen aus Afghanistan auf der Balkanroute handele es sich meist um Minderjährigen von 15 Jahren „und aufwärts“, sagt Svabic: „Bei den Syrern sind oft kleine Kinder von zwölf Jahren und jünger allein unterwegs.“ Oft hätte deren Eltern keine genaue Vorstellung, wie Familienzusammenführung funktioniere: „Sie denken, dass es der sicherste Weg ist, den ältesten Sohn mit zwölf Jahren auf die Reise zu schicken. Sie glauben, dass er in Deutschland automatisch Papiere und Asyl erhält – und dann der Rest der Familie nachkommen kann. Was so nicht stimmt.“
Angesichts der hohen Kosten von 15.000 bis 20.000 Euro für die Reise von der Türkei nach Deutschland erwarteten die Familien, dass die Kinder in zehn Tagen ans Ziel gelangen würden: „Doch die Kinder erhalten keine bessere Behandlung von den Schleppern, im Gegenteil. Meist hängen sie monatelang an jeder Grenze fest.“ Ihre Organisation versuche den Eltern in den Herkunftsländern die Gefahren aufzuzeigen, denen sie ihre Kinder aussetzen, sagt Ristic: „Aber oft ist ihre Verzweiflung so groß, dass sie ihre Kinder trotz des Wissens um die Risiken dennoch auf die Reise schicken.“
Pushbacks und Schläge gegen Kinder
Den Kindern wiederum mache „der Erwartungsdruck ihrer Familien zu schaffen“, so Ristic: „Selbst stark ausgebeutete und missbrauchte Kinder entscheiden sich darum selten, in einem der Transitländer zu bleiben und sich dort eine Existenz aufzubauen. Sie schicken stattdessen Selfies von Sehenswürdigkeiten der Städte, durch die sie ziehen, um den Eltern zu zeigen, dass es ihnen gut geht. Sie versuchen sich als jemanden darzustellen, der stark ist und auf dem von ihren Familien finanzierten Weg nach Europa weder klagt noch meckert.“
Im Schnitt seien die von ihr befragten Jugendlichen bereits vier Jahre unterwegs, so Ristic: „Das sind vier verlorene Jahre, mit traumatischen, sehr prägenden Gewalterfahrungen, ohne Unterstützung, ohne Gelegenheit, sich zu entwickeln.“ Die Erfahrung der Pushbacks und Schläge an den Grenzen mache die Kinder „älter und härter“: „Sie wachsen auf der Balkanroute mit der Erfahrung von Gewalt als Teil des Lebens auf. Die große Frage ist, was für Folgen das später in ihrem Leben haben wird. Und was mit ihnen geschieht, wenn sie nach fünf, sechs Jahren endlich an ihr Ziel gelangen.“
Druck der EU
Wichtig auf dem Westbalkan ist für die EU auch das Thema Migration. Zuletzt waren wieder deutlich mehr illegale Grenzübertritte über den Westbalkan in die EU gezählt worden – allein im Oktober rund 22.300 und damit fast dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Die EU fordert von den Balkanstaaten deshalb, ihre Visa-Politik an die der Europäischen Union anzugleichen. Bislang können etwa Menschen aus Indien visumfrei nach Serbien reisen, von wo aus sie zuletzt vermehrt in die EU weiterreisten und dort einen Asylantrag stellten. Serbien hob die Visafreiheit bereits für Tunesien und Burundi auf, Indien soll zum kommenden Jahr folgen. Doch die EU erwartet von Serbien und den anderen Ländern weitere Anstrengungen – zum Beispiel im Kampf gegen Schmugglerbanden. Für den Fall, dass die Länder ihre Visapolitik nicht anpassen, wurde sogar mit einem Aussetzen der aktuellen Regelungen zur Visafreiheit mit der EU gedroht.

 De Maart
De Maart

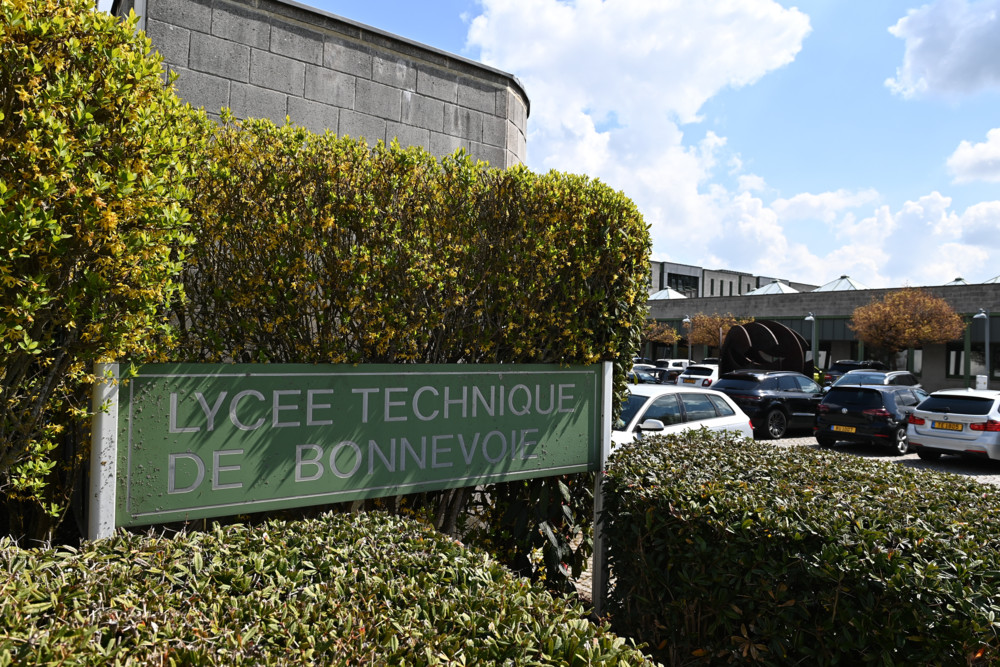





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können