Es ist ein Tappen, aber kein schleifendes, unbeholfenes Stolpern, sondern ein leichtes, bedächtiges
und von Neugier getragenes Vorwärtskommen – so kann man die Denkbewegungen von Ulrike Bail
beschreiben, die sie im 13. Band der vom CNL herausgegebenen „Rede zur Literatur“-Reihe
vollzieht. Das Ergebnis ist ein stilistisch trittsicherer, entsprechend den Vorlieben der Autorin
komprimierter Text, der Einblicke in ihren Schreibprozess gibt, aber auch etliche Reflexionen über
die Literatur, genauer die Lyrik enthält.
Einen Schwerpunkt legt Bail auf die Fragen, die sich in Kriegszeiten stellen, wenn unzählige
Menschen schwerste physische und psychische Verletzungen erleiden und die (poetische) Sprache
selbst zu einem Amputat, zu einem abgetrennten, nicht überlebensfähigen Rest zu verkommen
droht. In ihren Ausführungen bezieht sich Bail ausschließlich auf den russischen Angriffskrieg, da
der Text vor Beginn des Gaza-Israel-Kriegs verfasst wurde – die jüngsten Geschehnisse in der
Nahost-Region dürften ihren Aussagen eine noch größere Dringlichkeit verleihen.
Dichtung in Zeiten des Krieges
So fragt sie: „Ist es möglich, im Krieg zu schreiben? Angesichts dieses Krieges, dieses
Vernichtungskrieges Gedichte zu schreiben? Wie viel Abstand braucht man? Wie viele Kilometer,
Nächte, Sicherheiten? Kann man über den Krieg schreiben, wenn man im Sicheren sitzt?“ Für die
Autorin erscheint es evident, dass im Krieg selbst, an der Front, in den zerbombten Gebäuden, das
Kunstschaffen nahezu zu einer Unmöglichkeit wird.
Sie referiert auf die Lyrikerin Halyna Kruk, die in einer herausragenden Rede anlässlich der
Eröffnung des 23. Poesiefestivals in der Berliner Akademie der Künste sagte: „Gegen Leute mit
Maschinengewehren helfen keine Metaphern. Wenn dein Auto, mit dem du und deine Kinder dem
Krieg zu entfliehen versuchen, von einem Panzer überrollt wird, hilft kein Gedicht.“ Der Krieg
richtet die Menschen zugrunde und lässt ihre Stimmen verstummen, in einem Gedicht, das Kruk in
der bekannten Literaturzeitschrift „manuskripte“ veröffentlichte, heißt es zum Beispiel auch: „ich
bin jener, der explodiert ist, […] / man versucht, da zu sein / zu wachsen, zu beschützen und zu
führen […] / und zu stöhnen, zu stöhnen“. Im Krieg läuft das (poetische) Sprechen Gefahr,
unterhöhlt und zerrüttet zu werden, an ihren Platz tritt dann das laute, schwere und schmerzerfüllte
Ausatmen als Nicht-Sprache.
Und doch: Bail nennt auch den aus der Ukraine emigrierten Lyriker Yevgeniy Breyger, der in
Deutschland gegen den Krieg anschreibt, und die mittlerweile verstorbene Schriftstellerin Wiktorija
Amelina, die, als sie anfing als Kriegsverbrechensforscherin zu arbeiten, auch den Weg zur Lyrik
fand und ihre Erfahrungen in Worte fasste. „Die Sprache splittert“, so Bail, „verweigert sich dem
Gedicht und wird doch Gedicht.“ Mit Verweis auf die deutsche Poetin und Essayistin Anja Utler
spricht sie sich dafür aus, sich – gerade wenn man sich in Sicherheit befindet – den emotionalen
Abgründen zu stellen, die der Krieg geschaffen hat. Und dazu eignen sich besonders lyrische Texte:
„Gedichte können vieles sein. Auch ein Zelt, in dem man vorübergehend Zuflucht findet. […]
Gedehnte Möglichkeitsräume, dort wo es am not-wendigsten ist. Freiheitsräume. Trosträume.“
Keine Satzzeichen, keine Groß- und Kleinschreibung
Die freiberufliche Schriftstellerin spricht auch über ihren Schreibprozess, dessen Beginn sie im
Nachhinein häufig nur mehr schwer nachverfolgen kann: „Oft bleibt der Anfang im anamnetischen
Dunkel, unbewusst, verborgen, unfassbar, nicht mehr zu benennen“. Anstoß für einen Text könne
ein einziger Begriff geben, zum Beispiel das wohlklingende Wort „ormeau“, das auf Französisch
sowohl „Seeohr“ als auch „junge Ulme“ bedeutet und so das Meer und den Wald plötzlich in einen
verblüffenden Zusammenhang stellt. Termini, die – womöglich auch nur in anderen Sprachen –
durch Klang oder Semantik miteinander verschwistert sind, sind für Bail ein Faszinosum. Mit ihrer
Lyrik deckt sie kaschierte Wort- und Sprachverbindungen auf, lässt durch das Neben- und
Gegeneinanderhalten von Begriffen Assoziationsräume entstehen, in denen sich unterschiedliche
Ideen und Register miteinander vermischen.
Die deutsch-luxemburgische Autorin beleuchtet auch die formal-ästhetischen Aspekte ihrer
Dichtung, der allgemein eine gewisse Opazität nachgesagt wird. Sie verwische die Spuren, indem
sie auf Satzzeichen verzichte, schreibt sie. „Wohin gehört das Verb, wohin das Nomen, wohin die
Nennung des Orts, wenn kein Komma und kein Punkt Anfang und Ende markieren? Lese ich den
Satz von vorne oder von hinten […].“ Interpunktionszeichen gliedern oder zergliedern gar den Text;
ihr Fehlen verleiht dem Geschriebenen eine größtmögliche Offenheit und Ambiguität, welche viele
Deutungen erst möglich macht. Dabei gehe es aber nicht darum, Informationen zu entschlüsseln,
unterstreicht Bail, es gebe kein richtig oder falsch im Verstehensprozess.
Dass die Autorin auf Groß- oder Kleinschreibung verzichtet, hat ebenfalls einen Grund. So würden
die Rangordnung zwischen den Wörtern aufgelöst und eine Uneindeutigkeit geschaffen, welche die
Rezipient*innen dazu zwinge, genauer zu lesen, sich langsamer fortzubewegen, auf bestimmte
Wörter wieder zurückzukommen und sich von ihren eigenen Erwartungen und Hypothesen, was
dies oder jenes bedeute, allmählich zu lösen. Ohne Klarblick dort zu simulieren, wo Unsicherheit
prävaliert, fragt Bail nach dem (un-)authentischen Charakter des Gedichts („Wie viel wird getarnt?
Wie viel offengelegt? Wie viel ausgelassen?“) und dem Ende des Schreibprozesses („Ist ein Gedicht
je fertig?“). Bails Essay schließlich ist eine Verbeugung vor all den poetologischen Fragen, welche
die Schreibenden, ohne das es eine Auflösung gäbe, begegnen und wiederbegegnen, mit jedem
Wort, das sie aufs Papier bringen.
Infos
Die Essay-Reihe „Rede zur Literatur“ entstand im Rahmen der Autorenresidenz im Literarischen Colloquium Berlin, die organisiert wird von den „Lëtzebuerger Bicherfrënn“ und Kultur LX (früher übernahm diese Aufgabe der „Fonds culturel national“). Mittlerweile können auch Autoren, an die keine Autorenresidenz vergeben wurde, an dem Projekt teilnehmen. Die Reihe wird herausgegeben vom „Centre national de littérature“. Folgende Autoren haben sich bereits beteiligt: Tom Nisse, Ian De Toffoli, Rafael David Kohn, Elise Schmit, Jacques Steiwer, Jean Portante, Pierre Joris, Tom Reisen, Margret Steckel, Nora Wagener, Samuel Hamen, Ulrike Bail.
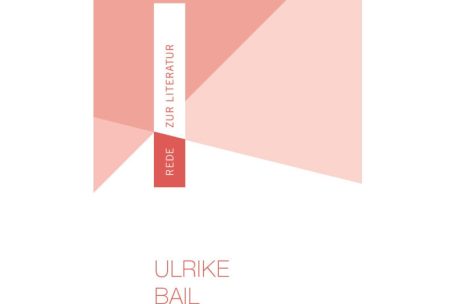








Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können