Mit Tränen in den Augen rang der erfahrene Diplomat angesichts der unerwarteten Solidaritätskundgebung vor seinem Amtssitz im serbischen Belgrad um seine Fassung. Er wolle sich für die angebotene Unterstützung „von Herzen“ bedanken, versicherte Kroatiens Botschafter Hidajet Biscevic Ende Dezember den Serben, die ihm nicht nur in hunderten von Mails, sondern auch persönlich Hilfe für die Erdbebenopfer in seinem Heimatland angeboten hatten: „Es ist schwer mit Worten zu beschreiben, wie viel das bedeutet.“
Vielleicht habe er auch noch einige Vorurteile, erklärte der Botschafter später in einem Interview seine sehr emotionale Reaktion auf die spontanen Hilfsangebote: „Ich hatte so etwas in Belgrad überhaupt nicht erwartet.“
Entspannterer Alltag
Gegenseitige Aufrechnungen und Dauerzwist: Drei Jahrzehnte nach dem Zerfall Jugoslawiens belasten die Kriege der 90er Jahre noch stets die politischen Beziehungen der sieben Nachfolgestaaten. Die Aussöhnung ist ausgeblieben: An der Anerkennung der Opfer anderer Völker lassen es die einstigen Kriegsgegner genauso mangeln wie an aufrichtigen Schuldbekenntnissen für im Namen der eigenen Nation begangene Kriegsverbrechen.
Doch obwohl nationalistisch gestrickte Politiker und Medien vor allem vor Urnengängen und an Kriegsjahrestagen weiter kräftig alte Animositäten schüren, hat sich zumindest der Nachbarschaftsalltag der Ex-Brudervölker etwas entspannt. Zwar sind die Berührungsflächen ohne den gemeinsamen Staat geringer geworden. In Ljubljana, Sarajevo, Skopje oder Zagreb führen keineswegs mehr alle Wege nach Belgrad – im Gegenteil. Aber dennoch sind sich die ex-jugoslawischen Völker nicht nur wirtschaftlich verbunden geblieben.
Weniger aus Angst vor zerkratztem Autolack als aus Kostengründen reisen heute Serben im Urlaub meist lieber nach Griechenland als nach Kroatien. Der vertraute Geschmack kennt im ex-jugoslawischen Vielvölkerreich hingegen keine neuen Grenzen. Serbische „Smoki“-Flips sind in kroatischen Supermärkten wieder genauso gefragt wie kroatische „Cedevita“-Trinkbrause in Slowenien oder slowenische „Cockta“-Limonade in Serbien.
Konsequent betrachtet nicht nur die kroatische Atlantic Grupa, unter deren Dach viele der ex-jugoslawischen Traditionsmarken produziert werden, die Region als gemeinsamen Wirtschaftsraum: In Serbien erwirtschaftet der Nahrungsmittelkonzern fast einen genauso hohen Umsatz wie auf dem kroatischen Heimatmarkt. Auch für Unternehmen in Bosnien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Slowenien und selbst im Export-schwachen Kosovo bleiben die ex-jugoslawischen Nachbarn weiter der wichtigste Absatzmarkt.
Als Kroatiens „Feurige“ bei der Fußball-WM 2018 bis ins Finale stürmten, drückten ihnen auch die Fans in Serbien trotz aller Rivalität mehrheitlich die Daumen. Die betagten Jugo-Nostalgiker, die am Geburtstag des einstigen Staatenlenkers Josip Broz „Tito“ mit roten Halstüchern und geballten Fäusten zu seinem Grab nach Belgrad oder seinem Geburtshaus im kroatischen Kumrovec pilgern, sterben 41 Jahre nach dessen Tod zwar langsam aus. Doch vor allem in Kultur und Wissenschaft floriert die sogenannte „Jugosphäre“.
Sicherlich seien die Bande lockerer geworden, doch zumindest in bestimmten Bereichen „lebt Jugoslawien als kultureller Raum weiter fort“, sagt die Belgrader Anthropologin Lada Stevanovic. Ob Schauspieler, die in TV-Serien oder an Theatern der Nachbarstaaten auftreten würden, oder Musiker, die durch ganz Ex-Jugoslawien tourten: „Es gibt einen ständigen Austausch. Viele fühlen das Bedürfnis, diese Verbindungen zu erhalten – und neu zu beleben.“
Zu jung für Nostalgie
Gelegenheit zur ganz persönlich gelebten Liebe zwischen den Völkern gab es im zerfallenen Jugoslawien genug. Schon im Wehrdienst wurden junge Bosnier, Kroaten, Serben oder Slowenen bevorzugt in einen anderen Landesteil abkommandiert. In Arbeitsbrigaden kamen sich junge Jugoslawen genauso nahe wie beim Studium oder im Sommerurlaub an der Adria. Der Anteil der ethnisch gemischten Ehen stieg zu jugoslawischen Zeiten stetig an. Nicht nur unter dem Druck der Ereignisse, sondern auch der eigenen Familien sollten allerdings viele Mischehen während der Kriege der 90er Jahre zerbrechen.
Grenzüberschreitende Verwandtschaftsbande hegen noch viele. Die Erfahrungswelten junger Serben, Kroaten oder Kosovo-Albaner haben sich in den letzten drei Jahrzehnten indes merklich getrennt. Doch obwohl sie sich schlechter oder kaum mehr kennen, sind die zwischenmenschlichen Bande zwischen den geplagten ex-jugoslawischen Völkern keineswegs so schlecht wie die politischen Dauerturbulenzen vermuten lassen.
Unter der jungen Generation macht Stevanovic 30 Jahre nach dem Zerfall Jugoslawiens „auch eine frische Neugier“ nach den Nachbarn aus. Zumindest diejenigen Jungen, die „die Kriege der 90er Jahre nicht als die ihren betrachten“, würden wieder in die Nachbarstaaten reisen und „neue Kontakte knüpfen“: „Sie sind keine Jugo-Nostalgiker, dafür sind sie zu jung. Aber sie interessiert der gemeinsame Raum einfach – und die Sprache erleichtert ihnen den Zugang.“

 De Maart
De Maart

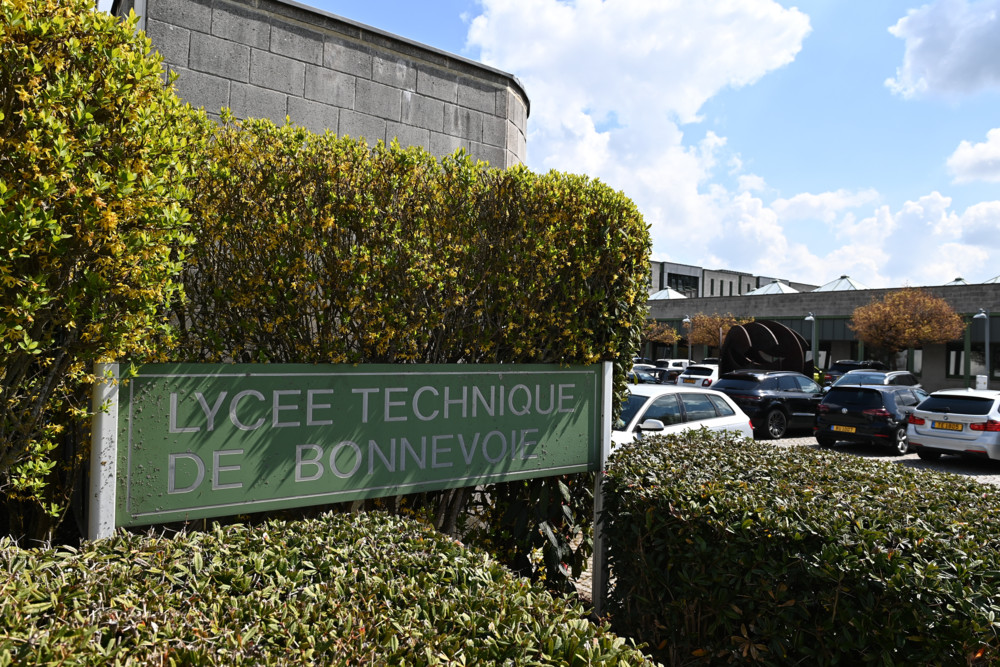





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können