Keiner der beiden Männer will den Mund aufmachen. Die Fragen sind heikel: die Haftstrafe für Alexej Nawalny, der Palast des Präsidenten, die Proteste. „Wir leben in einem recht totalitären Staat. Da schweigt man besser“, sagt der Jüngere. In der lichtdurchfluteten Markthalle verkauft er goldgelben Honig in großen Trögen: Wiesenhonig, Lindenhonig, Buchweizenhonig. Sein Kunde, ein 62-Jähriger in schwarzer Freizeitkluft, lässt sich gleich mehrere Plastikeimer geben. Pensionisten in Twer bekämen an die 100 Euro Pension. Gerade habe er noch Geld. Und dann sprudelt es aus ihm heraus. Warum Menschen wie er kein normales Leben führen könnten, fragt der Mann, wenn doch russische Staatsfirmen wie Gazprom Milliarden verdienten. Eine Ungerechtigkeit. Nawalnys Doku? Natürlich hat er sie gesehen. Wladimir Putin sei Besitzer des Palastes, ist er überzeugt. „Und wenn schon“, wendet der Honigverkäufer ein. „Immerhin ist er Präsident.“ Es sei nichts dagegen einzuwenden, wenn der Kreml-Chef das Gebäude mit ehrlich verdientem Geld gebaut habe. Ist das so? Schulterzucken. „Schau dir Merkel an“, wendet sein Kunde ein. „Die lebt in einer Wohnung und geht selbst einkaufen.“ Unvorstellbar für russische Politiker.
Twer ist eine Stadt in Zentralrussland mit 400.000-Einwohnern. Straßen im Schachbrettmuster, eine lebendige Fußgängerzone. Zwar verbindet ein Hochgeschwindigkeitszug Twer in nur 64 Minuten mit Moskau. Doch die Hektik der Metropole ist fern. Fern waren bisher auch politische Skandale und die Polarisierung der Menschen in Anhänger und Gegner des Präsidenten. Wie in vielen Provinzorten enthielt man sich lieber der Meinung: Bringt doch nichts, sich aufzuregen. Könnte gar gefährlich sein.
Doch nun haben die Erschütterungen der letzten Wochen auch die Regionen erfasst. In Twer fanden Proteste statt. Am 23. Januar versammelten sich 3.000 Menschen im Zentrum und zogen durch die Straßen. Es war die größte Kundgebung seit vielen Jahren. Der Honigkäufer war dort. Friedlich sei es gewesen. „Keiner hat Brandsätze geschmissen oder sich geprügelt.“ Als Anhänger Nawalnys will er sich dennoch nicht verstanden wissen. Für ihn und viele andere Bürger sei die Verurteilung des Oppositionspolitikers einfach Anlass gewesen, um ihren Unmut auszudrücken.
Fehlende demokratische Mitbestimmung
Auch Julia Orlowa hat das Aufwachen der Provinz bemerkt. Orlowa ist Chefredakteurin der unabhängigen Lokalzeitung Karawan. Die Redaktion befindet sich im ersten Stock eines verfallenen Jahrhundertwende-Hauses. Von hier aus kommentiert sie allwöchentlich das Geschehen in der Gebietshauptstadt – ruhig und besonnen, mit politischem Weitblick. Normalerweise versammelten sich in Twer gerade mal 100 Menschen bei Kundgebungen – „meistens Omas“. Doch dieses Mal betrat eine neue Generation die Straße. Viele junge Erwachsene um die 30 waren da. „Selbstsichere, gut ausbildete Menschen“ seien das, sagt Orlowa. „Anders als die Elterngeneration lassen sie sich nicht mehr so leicht von der Staatsmacht einschüchtern.“ Russische Soziologen beobachten die Aktivierung der jungen Generation schon länger in den Großstädten. Aber im provinziellen Russland ist das neu.
Wie der Mann vom Markt geht auch Orlowa davon aus, dass die vom Kreml gewollte Verurteilung Nawalnys für viele als Katalysator wirkte. Hinter dem unerwarteten Aufschrei steckten vor allem lokale Probleme, sagt die Chefredakteurin. Als Beispiel erwähnt sie die fehlende demokratische Mitbestimmung. Seit vielen Jahren ist es in Russland üblich, dass Lokalpolitiker wie der Gouverneur vom Präsidenten ernannt werden. Deren Bestätigung in einer späteren Wahl ist meist nur noch Formsache. Wird ein Beamter also in ein Gebiet verschickt, muss er sich vor der Staatsspitze bewähren. Die Bürger sind in diesem Wettbewerb nur Nebensache. „Wir haben bereits den dritten Gouverneur, der nicht von hier kommt“, beschreibt Orlowa die Mängel des Zentralismus aus der Sicht der Bürger. „Auch der Amtierende will eigentlich nur weg auf höheren Posten in Moskau.“
Schon im Vorjahr konnte der Kreml die Proteste in den Regionen nicht mehr ganz ignorieren. Im fernöstlichen Chabarowsk gingen wochenlang Tausende auf die Straße, um für die Freilassung des früheren, in Ungnade gefallenen Gouverneurs zu demonstrieren. Der Mann war einer der „Ihrigen“, ein beliebter Lokalpolitiker. Doch gilt eine Faustregel: Geht es um Fragen der Müllentsorgung, um Straßenbauprojekte oder Stadtverschönerung, sind häufig Kompromisse mit den Behörden möglich.
Man sagt uns die ganze Zeit: Tut das nicht, sonst wird es schlechter. Also tun wir nichts und erfahren nie, ob es nicht besser werden könnte.
Nicht so bei Kundgebungen, die als klar oppositionell gelten. In Chabarowsk mauerten die Behörden, der Protest verlief sich schließlich. Bei den Nawalny-Kundgebungen setzte es schon bald eine harte Antwort. Auch in Twer. Beim zweiten Meeting am 31. Januar wurden Teilnehmer von Anfang an festgenommen – insgesamt 200 Menschen. Darunter waren auch zwei Journalisten. „Ohne Angabe von Gründen“ habe man sie trotz Journalistenausweis für drei Stunden festgehalten, erzählt die 29-jährige Darija Samarina in einem Pub nahe des Wolgaufers. Die Kundgebungen mögen aufgelöst sein. Doch die Polarisierung nimmt zu. Auch Samarina beobachtet nach den aktuellen Ereignissen eine zunehmende Bereitschaft zur Konfrontation. „Die Menschen teilen sich in zwei Gruppen: jene, die Putin nach wie vor unterstützen, und jene, die ihn ablehnen und bereit sind, ihre Position zu verteidigen“.
Wie der Stillstand der Breschnew-Ära
Neben Samarina hat der Restaurateur Anton Pawlow Platz genommen. Er war bei den Demos nicht dabei, da er arbeiten musste. In Gedanken aber hat der Mann mit dem blonden Dreitagebart die Proteste unterstützt. Dabei ist Pawlow kein Oppositioneller, wie ihn die Propaganda des Regimes gern an die Wand malt. Der Mann ist Unternehmer. In den 90ern besuchte er einmal für zwei Wochen Irland – ein Erlebnis, das ihn geprägt hat. Sein Bierpub ist anders als viele Lokale in Twer minimalistisch eingerichtet. „Unsere Gäste brauchen keinen Firlefanz.“ Pawlow, 45, blickt zurück auf sein bisheriges Leben. Als Putin an die Macht kam, da habe er mit dem „jungen Präsidenten“ sympathisiert, erzählt er. Nun, 20 Jahre später, erinnere ihn die Gegenwart eher an den Stillstand der Breschnew-Ära. „Wenn das noch zehn Jahre so weitergeht“, grübelt Pawlow und nimmt einen Schluck von seinem Bier. „Was dann?“
Pawlow weiß nicht, wer Präsident werden sollte, er hat keine klaren politischen Präferenzen. Aber er beschreibt das Gefühl der russischen Gegenwart, das immer mehr teilen, nicht nur in Moskau und St. Petersburg, sondern auch in Kirow, Kemerowo und eben in Twer. Das Gefühl der Ermüdung durch ein Regime, das jegliche Veränderung blockiert, um seine Macht zu erhalten. Angst zu säen vor einer Revolution, vor einem Krieg – das sei die Strategie der Herrschenden, glaubt Pawlow. „Man sagt uns die ganze Zeit: Tut das nicht, sonst wird es schlechter. Also tun wir nichts und erfahren nie, ob es nicht besser werden könnte.“

 De Maart
De Maart

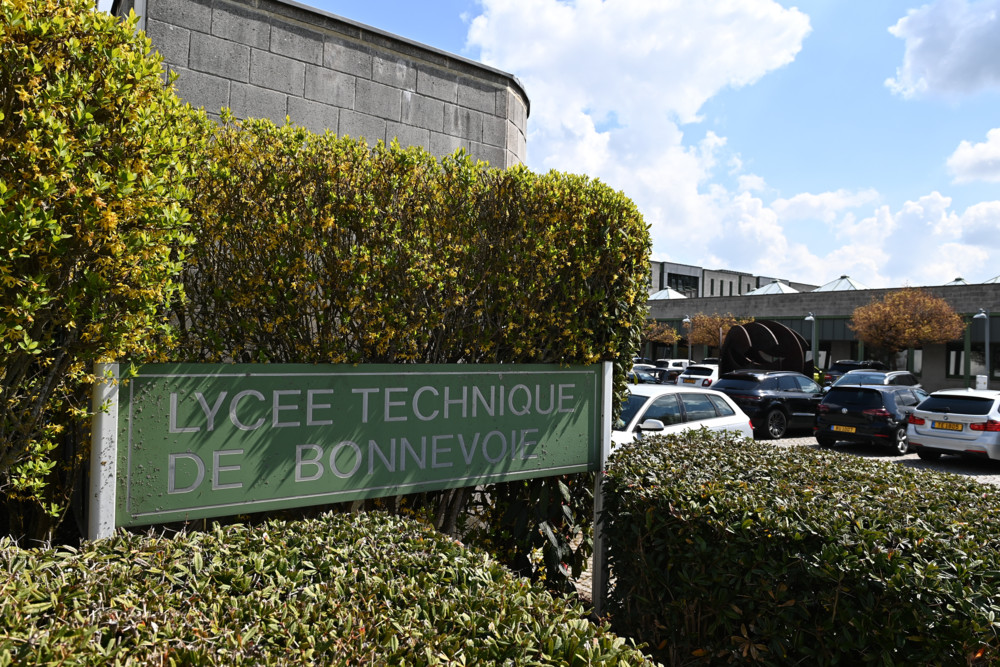





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können