Die Geschichte des Luxemburger Südens auf neuen Wegen erkunden.
Das unter dem Kürzel C2DH bekannte „Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History“ möchte den Aufbau und den Wandel der Industrieregion aus der Sicht der „Minettsdäpp“ studieren. Dafür braucht es über das reine Archivmaterial hinaus persönliche Objekte, die eine individuelle Geschichte erzählen.
Der Helm, mit dem der Großvater seinerzeit „erof an d’Minn“ gestiegen ist. Die Karbidlampe, die ihn dabei begleitet hat, der „Buggy“, der im Garten stand, der Sonntagsstaat, in dem die Familie zur Messe ging, oder das Akkordeon, mit dem zum Tanz aufgespielt wurde. Es sind ganz konkrete Dinge, Alltagsgegenstände und Erinnerungsstücke, die die Historiker der Uni Luxemburg zusammentragen möchten, um die Geschichte der „Minettsdäpp“, der Leute aus dem Süden des Landes, zu dokumentieren.
Es geht ihnen dabei nicht um die Entwicklung der Schmelzen, die bereits anderweitig ausführlich besprochen wurde, sondern um die Menschen, die aus dem ganzen Land und dem Ausland nach Esch, Differdingen, Düdelingen oder Schifflingen gezogen sind, um in den dortigen Berg- und Stahlwerken ihr Geld zu verdienen. Wie haben sie ihren Alltag gelebt? Was war ihnen wichtig, wo lagen ihre Prioritäten, ihre Wünsche, vielleicht ihre Frustrationen? „Wir wollen die Geschichte dieses Mal von unten nach oben hin aufarbeiten“, sagt Stefan Krebs, einer der an der Forschung beteiligten Historiker.
„Wir waren ein wichtiger Teil des Bid Book“
Genau wie seine Kollegin Karin Priem ist er vorerst äußerst vorsichtig. Nach einem ersten Appell ans Publikum, im Rahmen einer am 16. Juni vom C2DH häufig genutzten „Forum Z“-Veranstaltung zur Frage, wie und von wem Industriegeschichte geschrieben werden sollte, ist das Forschungsvorhaben ein wenig ins Stocken geraten. Einerseits weil die an die Interessierten gerichteten Anfragen nach Gebrauchsgegenständen weitgehend erfolglos blieben, andererseits weil dieses präzise Forschungsvorhaben ein Teil des „Esch 2022“-Projektes war und demnach vorerst auf Eis liegt.
„Wir waren ein wichtiger Teil des ‚Bid Book‘, der die Kandidatur von Esch als Europäische Kulturhauptstadt unterstützte. Wir mussten der Jury darüber genau Rede und Antwort stehen“, so die Wissenschaftler. Genau wie alle anderen Akteure müssen sie jetzt warten.
Ihr Interesse wurde dadurch nicht geringer. Nach wie vor suchen sie nach Tagebüchern, vielleicht einem Talisman, den der Bergarbeiter mit unter Tag nahm, nach Arbeits- und Lohnbüchern und natürlich nach vielen Fotos, wobei auch hier die Sichtweise des einfachen Mannes bestimmend ist. Die historische Aufbereitung durch die Uni soll die persönlichen Erinnerungen wissenschaftlich aufarbeiten.
„Mit alternativen Methoden der Forschung lebendige Geschichte schreiben“
Ein weiterer Schwerpunkt der Recherche sind die Umwelt und die nachhaltige Entwicklung der Südregion. Gearbeitet wird auch an der Stadt- und Technikgeschichte, an der sozialen Entwicklung der Region sowie dem Alltagskonsum, mit einer Analyse der Konsummöglichkeiten unter dem Einfluss der Industrialisierung. „Mit alternativen Methoden der Forschung lebendige Geschichte schreiben“, bringt Karin Priem das Projekt auf den Punkt. Wichtig sind ihr die Zeitzeugenberichte. „Wir sollten die Erlebnisse der Bergarbeiter einfangen, bevor es zu spät ist“, überlegt die Historikerin, die im Rahmen ihres Projektes auch die Tageszeitungen durchforsten will. Und dann setzt sie natürlich stark auf Fotos.
„Es soll keine Kunstfotografie sein, sondern Bilder aus dem Familienalbum“, unterstreicht sie wiederum. Ein gutes Dutzend Wissenschaftler, darunter sechs Doktoranden, sollen in das Forschungsprojekt eingebunden werden. „Dokumentieren, wie es zur Industrialisierung kam und wie sich die Gegend nach dem Ende der Stahlkrise und der Schließung von Bergbau und Schmelzen anders entwickelt hat“, erklärt Stefan Krebs.
Erforschung der Mobilität
Einen ersten konkreten Fundus haben die Wissenschaftler schon ausgemacht. Die 2.000 Fotos aus dem „Fonds Jean-Pierre Conrardy“ dokumentieren perfekt den Aufbau und den Abriss der Schmelzen in Düdelingen, genau wie das Abtragen der Schlackenhalde, auf der heute ein Supermarkt steht. Auch mit dem Flurnamen des heutigen Uni-Standortes haben sich die Historiker schon beschäftigt. „‚Belval‘ heißt ja eigentlich ’schönes Tal‘. Es war ein Naherholungsgebiet, in dem die Leute sonntags spazieren gingen und in einem Gartenlokal einkehrten. Als 1865 hier Heilwasser entdeckt wurde, gab sein Entdecker, Joseph Steinen, dem Tal den Namen.“
Zum Stichwort Belval gesellt sich ein weiterer Aspekt des umfangreichen Projektes. „Belval und Esch scheinen mitunter meilenweit auseinander zu liegen. Dabei sind Tausende die Strecke täglich zur Arbeit gelaufen, mit dem Rad oder mit Tram und Bus gefahren. Die Erforschung ihrer Mobilität ist ein weiterer interessanter Aspekt unserer Arbeit.“ Und nochmals geht der Appell an die Leute aus dem Süden: „Kramt in euren Erinnerungen! Jedes noch so unbedeutende Detail kann Teil eines spannenden Ganzen sein.“
Erinnerung
In einer neuen Form der Geschichtsschreibung wollen die Historiker des C2DH nicht nur auf Archivmaterial zurückgreifen, sondern auch persönliche Souvenirs auswerten. Sie sind deshalb auf der Suche nach allen möglichen Erinnerungsstücken. Diese werden der Uni zeitweilig zur Verfügung gestellt, wo sie dokumentiert und digitalisiert werden, bevor sie selbstverständlich ihren Besitzern zurückerstattet werden.
Einen ersten Anfang machte die 150 Jahre alte Escher „Harmonie des mineurs“, die der Uni ihren gesamten Fotobestand zur Verfügung stellte. „Daraus lassen sich schon erste Schlüsse ziehen“, so Karin Priem. Karin Priem und Stefan Krebs sind auch die Ansprechpartner für eventuelle Leihgaben. Zu kontaktieren sind sie per E-Mail an [email protected] bzw. [email protected]. Weitere Informationen zum Projekt auf www.c2dh.uni.lu.
Forschung zur Industriegeschichte
Momentan stehen zwei Doktorarbeiten zur Geschichte der Stahlindustrie und ihren transnationalen Bezügen vor dem Abschluss. Eine erste beschäftigt sich mit der brasilianischen Niederlassung der Arbed. Mit der „Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira“ hat der Stahlproduzent nicht nur Geld verdient, er hat auch die hiesigen sozialen Initiativen dorthin exportiert. Bezeichnend ist vor allem der Ingenieur Louis Ensch, der den Sozialdialog als „Luxemburger Modell“ in leicht angepasster Form bis nach Minas Gerais exportiert hat.
Eine zweite wissenschaftliche Arbeit hat sich mit der Frage befasst, wie nicht nur Bilder und Filme, sondern auch Postkarten und Reiseführer Luxemburgs Identität als Industrienation dargestellt und wesentlich geprägt haben.

 De Maart
De Maart




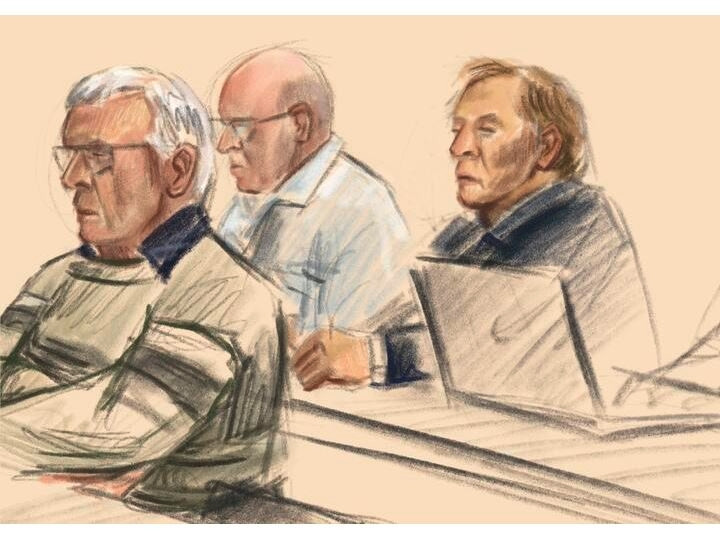



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können