Seit Jahren kursieren Gerüchte über Millionen Euro an jüdischem Eigentum, das auf Konten luxemburgischer Banken „schlafen“ soll. Jüdische Nachfahren erheben Anspruch auf diese Gelder. Dem Tageblatt liegt nun ein offizieller Bericht über die sogenannten „Comptes dormants“ vor, der bislang im Staatsministerium unter Verschluss lag.
Es ist ein sonniger Tag in der „Groussgaass“. Ein Mann im Anzug isst sein Sandwich, bewegt sich flotten Schrittes voran. Eine ältere Frau flaniert vorbei am Schaufenster eines Schuhgeschäfts, schenkt ihrem Hund an der Leine keine Beachtung. Und ein Straßenmusiker kämpft mit Stimme und akustischer Gitarre gegen den Presslufthammer der Baustelle am „Aldringen“ an. „Hier ist es“, sagt Karin Meyer. Sie zeigt auf ein Lederwarengeschäft. 62, Grand-rue. „Hier war einmal der Malerbetrieb meiner Großeltern. Bis man ihn uns genommen hat. Bis die Nazis ihn weggenommen haben.“ Karin Meyer ist die Nachfahrin einer jüdischen Familie. Ihr Urgroßvater Martin Abramowicz, 1889 im polnischen Wielun geboren, war 1929 mitsamt Familie nach Luxemburg gezogen und hatte einen Malerbetrieb in Luxemburg-Stadt eröffnet. Die Familie soll sich gut integriert haben, die Kinder gingen zur Schule, waren bei den Pfadfindern und im Fußballverein. Das Geschäft lief.
Doch dann kam der Bruch. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten, der zunehmende Antisemitismus in Luxemburg und schließlich die Enteignung nach dem deutschen Einmarsch von 1940. Karin Meyer versucht seit Jahren, die Geschichte ihrer Familie zu rekonstruieren. Und sie will eine Ungerechtigkeit ausgemacht haben. Ihre Familie habe weder für die Enteignung des Betriebs noch für sonstiges Leid eine Entschädigung erhalten. Auch nicht ihr Urgroßvater Jean Abramowicz, der als Halbjude zwangsrekrutiert wurde.
Seit der Erscheinung des Artuso-Berichts von 2015 kämpft Karin Meyer für das, was sie ihr Recht nennt. Zu lange sei geschwiegen worden, zu lange habe sie und ihre Familie das Geschehen einfach hingenommen. Sie hat Recherchen im Nationalarchiv unternommen, sich an Historiker und Politiker gewandt sowie an die damalige Ombudsfrau Lydie Err, die ihr Dossier an den Premierminister gereicht hat. Und im Februar 2016 erhielt sie eine schriftliche Antwort von Xavier Bettel. Es sei „kein Schaden“ festgestellt worden, so der Premierminister. Zudem waren alle Familienmitglieder „polnischer Nationalität“, was sie sowieso von „einer Entschädigung ausschließt“.
Eine Frage des Schadens
Karin Meyer will sich mit dieser Antwort nicht zufriedengeben. Sie will belegen, dass ihrer Familie „Schaden“ zugetragen wurde. Sie hat sich dafür juristischen Beistand geholt. Ihre Anwältin, Sabrina Martin, hält dabei den zweiten Teil der Antwort des Premiers für anfechtbar, für nicht vereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950. Demnach dürfen Menschen nicht aufgrund ihrer Nationalität diskriminiert werden.
Zudem hat sich Karin Meyer mit einem emotionalen Leserbrief „Ich bin Jüdin und klage an“ an die Presse gewandt, ist bei „déi Lénk“ eingetreten und hat Parteikollege Marc Baum dazu bewogen, eine parlamentarische Anfrage an Xavier Bettel zu stellen, der darüber hinaus Aufklärung erhalten will über die „Comptes dormants“ – schlafende Konten mit jüdischem Eigentum. „Es geht mir dabei längst nicht mehr nur ums Geld, sondern ums Prinzip für alle nicht-luxemburgischen Juden, denen Unrecht getan wurde“, so Meyer. Notfalls will sie bis vor den Europäischen Gerichtshof nach Straßburg ziehen.
Der Historiker Paul Dostert hat den Premierminister im Fall Abramowicz/Meyer beraten. Er hat nach Quellen gesucht, den Fall analysiert, Schlüsse gezogen – also genau das, was er eigentlich sein ganzes Leben gemacht hat. Denn Dostert gilt als Historiker-Institution in Luxemburg. Seit seiner Dissertation von 1985 „Luxemburg zwischen Selbstbehauptung und nationaler Selbstaufgabe. Die deutsche Besatzungspolitik und die Volksdeutsche Bewegung 1940-1945“ war er der führende Experte der Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Luxemburg. Er legte mit seiner Forschung vor allem den Blick auf Leid und Erfahrung der Luxemburger. Er hat dabei keineswegs Kollaboration oder Judenverfolgung unterschlagen, aber allein durch seine Perspektive hat sich das Opfernarrativ der Luxemburger Nation institutionalisiert.
Neues Narrativ
Seine öffentliche Deutungshoheit geriet erst ins Wanken, als die Historiker Serge Hoffmann und Denis Scuto 2012 eine neue Untersuchung der Kollaboration in Luxemburg sowie etwaige politische Verantwortung forderten. Es folgte der Artuso-Bericht 2015, in dem Historiker Vincent Artuso aufzeigen konnte, dass die Luxemburger Zivilverwaltung den Nationalsozialisten entgegen gearbeitet hat. Seither gilt – zumindest offiziell – das „Wir-waren-nicht-alle-Helden“-Narrativ.
Der Fall Abramowicz/Meyer war dabei einer der letzten Aufträge von Dostert überhaupt. Seit 2016 ist der Beamte in Rente, sein „Centre de documentation et de recherche sur la Résistance“ wurde aufgelöst bzw. im neuen zeithistorischen Institut integriert. Und Dostert hält den Fall für deutlich komplexer, als Karin Meyer ihn schildert. Er konnte für viele ihrer Behauptungen keine eindeutigen Belege finden. So gab es wohl einen Malerbetrieb Abramowicz in der „Groussgaass“, allerdings war die Immobilie nicht im Besitz der Familie. Zudem soll der Name Abramowicz auch nicht auf jüdischen Listen der Zivilverwaltung nachzuweisen sein. Und Jean Abramowicz, Jahrgang 1919, sei auch in Lothringen zwangsrekrutiert worden, er könne folglich keine Ansprüche an den Luxemburger Staat stellen.
Fehlende Beweise
Dostert will nicht missverstanden werden. Die Geschichte der Familie von Frau Meyer sei tragisch. Aber als Historiker im Staatsdienst gehe es nicht darum, moralisch mit den Kategorien von heute zu urteilen, sondern die Quellen nach Fakten und Tatsachen zu befragen. Und letztlich konnte er die Version von Frau Meyer mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft nicht nachweisen.
Dabei findet Dostert es grundsätzlich moralisch fragwürdig, dass nach dem Zweiten Weltkrieg lediglich Luxemburger ein Recht auf Entschädigung hatten. Aber als Grundlage gilt das Gesetz über die Kriegsschäden von 1950. Um Ansprüche zu stellen, mussten Ausländer, die in Luxemburg lebten, sich an das Land ihrer Nationalität wenden. Das galt auch für Juden so. Und die Gesetzgebung in den Nachbarländern war ähnlich.
Die Argumentation hat jedoch einen Haken, einen blinden Flecken. Für die Familie Abramowicz war das nämlich nicht möglich. Denn anders als der Premier es in seinem Schreiben angibt, waren sie staatenlos – sogenannte „Apatriden“. Ende März 1938 hatte die polnische Regierung die Aufhebung der Staatsangehörigkeit für alle verfügt, die sich länger als fünf Jahre außerhalb des Landes aufhielten. Das richtete sich vor allem gegen die Rückkehr polnischer Juden und machte auch die Abramowicz’ zu Staatenlosen. Sie konnten sich folglich an keinen Staat wenden.
„Comptes dormants“
Der Fall Abramowicz zeigt dabei den schwierigen Umgang Luxemburgs mit der jüdischen Enteignung. 2000 hat der LSAP-Abgeordnete Ben Fayot eine Gesetzesvorlage nach französischem Vorbild eingereicht, um die „spoliation des biens juifs“ zu untersuchen und gegebenenfalls Eigentum an die Nachfahren zurückzuführen sowie eine unabhängige Stiftung zur Erforschung und Bewahrung der Erinnerung an den Holocaust zu schaffen. Fayots Gesetzesvorlage wurde verworfen. Der damalige Premierminister Jean-Claude Juncker berief lediglich eine Kommission ein, die die Geschichte der jüdischen Enteignung untersuchen sollte. Der Vorsitzende der Kommission: Paul Dostert.
Es sollte neun Jahre dauern, bis die Dostert-Kommission im Jahre 2009 den Bericht vorlegte. Fazit: Insgesamt wurde Eigentum im Wert von 30 Millionen Reichsmark von rund 3.900 Juden enteignet. 3.000 von ihnen waren keine Luxemburger, konnten demnach auch keine Ansprüche auf Entschädigung stellen.
Der Dostert-Bericht hat dabei mindestens zwei Ungereimtheiten. Zum einen ist er nie offiziell von der Regierung vorgestellt worden. Zum anderen hat er keine Klarheit über die sogenannten „Comptes dormants“ gebracht. Es wurde gemutmaßt, dass es rund 200 solcher schlafenden Konten gibt, aber Näheres konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.
Seither verbreiten sich Legenden um die „Comptes dormants“ – regelrechte Verschwörungstheorien von Millionen Euro an jüdischem Eigentum, das auf den Konten Luxemburger Banken „schläft“. Auch Karin Meyer geht von diesen Millionen auf den „ominösen comptes dormants“ aus.
41.967 Euro
Paul Dostert kann sich über diese Legendenbildung nur wundern. Denn er hat 2014 einen Anschlussauftrag von der Regierung erhalten, die „Comptes dormants“ ausfindig zu machen. Und am 16. Juni 2016 hat er seinen vierseitigen Bericht der Regierung vorgelegt. Das Problem: Die Regierung hat den Bericht nie veröffentlicht. Warum? „Wir haben das irgendwie versäumt“, so die lapidare Antwort des Staatsministeriums.
Dabei räumt der Bericht, der dem Tageblatt vorliegt, zum Teil mit den Mythen auf. Dostert konnte lediglich 89 inaktive jüdische Konten ausfindig machen. Davon befinden sich 87 auf der Sparkasse und zwei auf der BIL. BGL und Post gaben an, keine inaktiven Konten aus den Jahren 1940-1945 zu haben. Gesamtwert der inaktiven Konten: 41.967 Euro. Allerdings heißt es, dass die Zinsen der Konten, die seit den 1970er-Jahren eingefroren sind, nachgerechnet werden müssen. Bei einem Durchschnittszinssatz von etwa vier Prozent seit 1970 entspricht das einem realen Wert von rund 250.000 Euro.
Dostert hat damals vorgeschlagen, die Namen der Kontenbesitzer ins Internet zu setzen, um etwaige Nachfahren ausfindig zu machen, ähnlich wie es in der Schweiz gehandhabt wurde. Sofern sich nicht für alle Konten legitime Erben finden sollten, sollte das Geld in eine neue Stiftung fließen, die „Fondation de la Shoah“, so wie es Ben Fayot in seiner Gesetzesvorlage von 2000 vorgeschlagen hatte. Auf Nachfrage hin teilt das Staatsministerium mit, dass die Nachfahren der Konten nicht ausfindig gemacht und das Geld auch nicht für sonstige Zwecke verwendet wurde. Allerdings habe man vor Kurzem offiziell eine Stiftung gegründet. Vereinfacht ausgedrückt: Die schlafenden Konten schlafen noch.
„Ein Skandal“
Für Henri Juda, den Gründer der Vereinigung Memoshoah und Nachfahren von Holocaustopfern, ist dieses Verhalten schwer hinnehmbar. Banken hätten die Pflicht, die Eigentümer ausfindig zu machen, auch ohne Aufforderung Dritter, so Juda, der 40 Jahre als Kader im Bankgeschäft in Luxemburg und der Schweiz tätig war: „Wenn etwas in unserem kapitalistischen System heilig ist, dann doch wohl das Eigentum.“
Doch es ist nicht das Einzige, was ihn am vierseitigen Bericht über die „Comptes dormants“ stört. Denn gleich zu Beginn teilt Dostert mit, dass er sich lediglich mit inaktiven Bankkonten beschäftigen wird und nicht mit inaktiven Wertpapierkonten. Aktien, Lebensversicherungen oder Anleihen bleiben also im Verborgenen. Begründung: Die Banken hätten sich schlichtweg geweigert, diese Informationen herauszugeben, da sie sich dafür nicht in der „moralischen Verantwortung“ sehen.
Juda hält diese Weigerung der Banken – einer staatlichen Kommission Informationen vorzuenthalten – für nichts Geringeres als ein „Skandal“. Niemand habe die Banken nach einer moralischen Verantwortung gefragt, es gehe nur darum, Auskunft über Eigentum zu geben. Ebenso fragwürdig findet er, dass sich Dostert mit dieser Antwort zufriedengegeben hat. Denn noch im ersten „Spoliation“-Bericht von 2009 steht, dass Wertpapiere im Wert von 10 Millionen Reichsmark beschlagnahmt und verkauft wurden. Das ist immerhin ein Drittel des konfiszierten Werts insgesamt. Umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro.
Auch Ben Fayot hält den vierseitigen Bericht für unbefriedigend. Sein ernüchterndes Fazit: Im Zweifel setze sich der Finanzplatz in Luxemburg stets gegenüber der Regierung durch. Aber er hofft, dass möglicherweise durch den Fall von Karin Meyer die Frage nach dem jüdischen Eigentum, die sich seit Jahrzehnten stellt, eine neu Dynamik erhält. Auch Henri Juda sieht die Geschichte nicht für beendet. Im Gegenteil: Das gesamte Parlament hat auf Basis des Artuso-Berichts eine Mitverantwortung an der Judenverfolgung eingestanden. Das sei eine Zäsur, die Geschichte der „spoliation des biens juifs“ müsse neu geschrieben werden.

 De Maart
De Maart




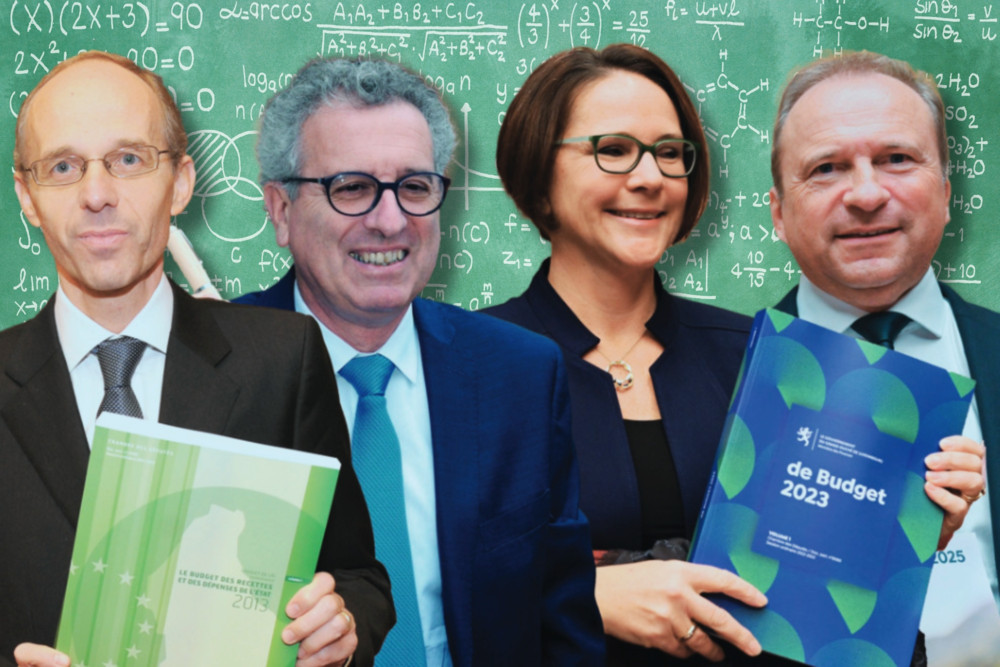



Bis zum Jahre 1950 war an der genannten Stelle in der Grand Rue ein Geschäft von einem Herrn Meyer. Nach dem Verkauf durch Herrn Meyer wurde daraus ein Lederwarengeschäft, bzw. wurde das Hinterhaus an den Ministère de l'interieur verkauft. Deswegen habe ich Schwierigkeiten, die hier vorgelegte Anklage nachzuvollziehen.
Dan V . Danke für die Ueberlegungen . Da ist vieles richtig . Heute müssen Banken von sich aus spätestens nach 3 Jahren aktiv nach den Erbberechtigten suchen , wenn der Inhaber sich nicht meldet . Früher war das sicher nicht so Daraus aber abzuleiten , dass nur das gemacht werden darf was unbedingt gemacht werden muss ist gerade nach dem Krieg sehr sehr fragwürdig
Darf ich Ihnen diesen Artikel von Frederic Braun in Woxx empfehlen . Der zuständige Historiker des Berichtes Spoliation wo ja diese 10 Millionen RM erwähnt waren , spricht heute in einem "rapport final" von dépôts titres "pour autant qu'ils aient existés " Na was denn nun ? do speizt en .... Der Gipfel ist allerdings wenn eine sehr fragliche schriftliche Stellungnahme einer Bank so ausgelegt wird als ob deren Argument " pas de responsabilité morale " ein allgemein gültiges Argument wäre, das man dann locker zu der Feststellung "vertieft" somit wäre keine Rückgabe nötig und man könnte die 10 Mio RM ( heutiger Wert ohne Zinsen und ohne Wertsteigerung ca 10 Mio EURO jetzt aussen vor wären !ma geht et nach ?
"Denn noch im ersten “Spoliation”-Bericht von 2009 steht, dass Wertpapiere im Wert von 10 Millionen Reichsmark beschlagnahmt und verkauft wurden."
Von wem beschlagnahmt? Und wer war der Begünstigte? Luxemburg oder Nazi-Deutschland?
Ausserdem: 1970 wurden die Konten eingefroren - und nicht gleich nach dem 2. Weltkrieg. Das heißt doch, dass es schon in den 1970ern Untersuchungen gegeben hat und Fakten vom Mythos getrennt wurden. Was wurde damals unternommen, um Eigentümer und Erben zu finden? Würde überhaupt etwas unternommen?
Und: es gibt ganz selten keine Nachfahren. Wenn ein Familienzweig ausgestorben ist, gibt es immer noch andere Zweige. Man muss nur weit genug zurückgehen. Wenn man natürlich nur nach direkten Nachfahren sucht, kann die Suche schnell zu Ende sein. Aber das Geld einer Stiftung übergeben statt an Menschen und dann ein Monument damit zu errichten, sehe ich persönlich nicht im Sinne der Verstorbenen. Das, was sie zeitlebens aufgebaut haben, war bestimmt nicht für Monumente, sondern für ihre Familien gedacht.
ich komme nicht umhin Monavisa zu sagen , dass ich seine Stellungsnahme sowohl inhaltlich als auch sprachlich hervorragend finde . Nun da ich selbst auch noch im Artikel , leider nicht ganz korrekt , zitiert werde will ich Folgendes klärend vermitteln .
die Fragestellung in unserem Luxemburger Fall ist doch eine ganz andere als die Debatte um das Gold ( inklusive Zahngold , das den Shoah-Vergasten aus dem Mund geschlagen wurde) , das über dubiose Nazikanäle zu sehr günstigen Konditionen an Schweizer Banken verhökert wurde , die damit Geschäfte machten . Da ich zu dieser Zeit in der Schweiz bei einer Luxemburger Bank arbeitete, kenne ich die Thematik recht gut . Uebrigens kann ich mich auch noch gut an die Antisemitismus Welle erinnern , die die damals bei den Eidgenossen aufkam . Natürlich haben Sie und Finkelstein mit Ihrem Verweis auf die US Anwälte nicht Unrecht .
Dazusollte man aber auch wissen ,dass diese Art Prozesse anzugehen , in den USA einfach so üblich ist . Die Rechtsanwaltbüros ( einige haben wir jetzt auch schon in Luxemburg, und der neue US Ambassador gehöhrt zu dieser Sippschaft) nehmen sich eines erfolgsversprechenden Falles an , vereinbaren eine exorbitante Gewinnbeteiligung und schiessen dann aus allen Rohren , und es ist normal , dass sie dann zum Schluss die wahren Gewinner sind .
Nun ziehen sie aber die falschen Schlüsse in Bezug auf Luxemburg . Obwohl hier so schrecklich Viel aus der Vergangenheit so total schief gelaufen ist , will ( so hoffe ich) die jüdische Gemeinschaft eben , vermeiden dass die Claimskonferenz hier auch zuschlägt und im Guten mit der Lux Regierung ( die ja im Kontext des Rapport Artuso , das Fehlverhalten der Com Administrative , bestätigt hat ), einen ehrbaren Kompromiss für beide Seiten finden . Auch im Hinblick auf das Image dieses Finanzplatzes . Mehr nicht . Die Opfer sind eh , bis auf 2-3 Ausnahmen mittlerweile verstorben .
Das ist eine Schande . Uebrigens für beide Seiten . In D, F und B wurden hier vor ca 20 Jahren lösungen gefunden . und 20 jahre bedeuten im diesem Zusammenhang enorm viel . Ernorm viele Ungerechtigkeiten , Unkenntnis , Unwissen-Wollen vielleicht sogar Verachtung . Währenddessen erhielt die Opfergruppe der Zwangsrekrutierten , die anständig Krawall machte und Bundespräsident Heinemann mit Eiern bewarf volle Genugtuung in Bezug auf zig Millionen Entschädigungen , die ihnen völkerrechtlich nicht nicht einmal zustanden . Die ich Ihnen ( bis auf wenige Ausnahmen wie den Mördern des PRB 101) auch gönne , Statenlose oder ausländische Juden erhielten bis dato Null . Nicht einmal eine moralische Anerkennung als victimes du nazisme . . keine psychologische Hilfe , ja sogar Gelder ( wie eben gerade der lux Anteil an diesem Schweiter Eizenstat Goldabpfindung) verschwanden ohne Information an die jüdische Gemeinde im Nirvana der Staatsfinanzen, wie mir ein damaliger Minister bestätigte .
Bis 2015 kannte die Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte , die Opfergruppe der Juden nicht . Wies sogar eine Nachfrage von MemoShoah über 9000 EUR , für eine wanderaustellung über das Schicksal der Luxemburger Juden ab , und dies obwohl diese Stiftung um 1945 gegründet wurde um den Kriegsopfern zu helfen . Also geschätzte(r) Monavisa es geht wirklich um eine Plünderung des armen Luxemburger Staates und seiner armen Bürger. Es geht darum einen fairen Kompromiss zu finden , auch zum Wohle des Images des armen Finanzplatzes , über dessen 70 jährige "Mauern" der grosen banken BIL und BGL ich mich nur wundern kann . Und wenn die Claims Conference da bis dato aussen vor bleibt , um so besser .
Leider kenne ich Beispiele , die fast keine Alternative zulassen ...