Nils Frahm, Calexico & Long Distance Calling gehen die Ideen einfach nicht aus. Wir besprechen hier ihre Musik. Eine neue Folge unserer Serie „Klangwelten“.
Heterogene Vignetten
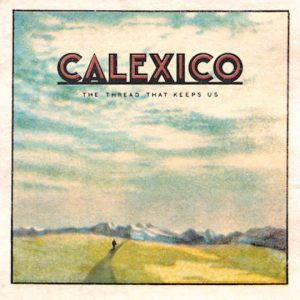

Calexico sind eine der beständigsten Bands der Indie-Musik. In über 20 Jahren hat die Band kein einziges schwaches Album produziert, sogar Altersmüdigkeit hat man ihnen bisher kaum ansehen können. Diese Begebenheit kommt allerdings Hand in Hand mit der Erkenntnis, dass das Calexico-Universum stilistisch ganz klar abgesteckt ist, die Band unverkennbar ist und, wenn es kein Ermüdungserscheinen seitens der Gruppe gibt, es vielleicht aber innerhalb der Zuhörerschaft irgendwann zu einem solchen kommen könnte.
So war dann meine Reaktion auf die Ankündigung, mit The Thread That Keeps Us würde wieder ein neues Calexico-Album erscheinen, eine etwas blasierte Vorfreude: Ich wusste, dass das Album toll werden würde, wusste aber auch schon, wie es klingen würde. Aber kann man einer Band vorwerfen, zu sehr nach sich selbst zu klingen – und das auch noch auf hohem Niveau während zwei Dekaden durchzuziehen?
Calexico antworten gleichgültig mit einem unaufgeregten, durchweg ausgezeichneten neuen Album, das den Trend, das Verhältnis zwischen Indie-Rock-Balladen und den Hispano-Einflüssen aus Salsa und Tarantino-Soundtrack erneut mehr in die Richtung von Ersteren zu verlagern, ohne die eigene Identität aufs Spiel zu setzen, fortführt.
Viele der hier aufgenommenen Songs hätten so eigentlich auch auf einem der Vorgängeralben fungieren können, die Band entwickelt sich in kleinen Etappen weiter, stellt die Grenzen ihres Mikrokosmos fast unmerklich um – seit „Carried to Dust“ (2008) geben sich Calexico songorientierter, Joey Burns singt selbstsicherer, die Mariachi-Trompeten rücken etwas in den Hintergrund. Oft steht der Band dies gut, nur manchmal, wenn sie sich zu sehr dem Indie-Rock-Lager annähern, klingen sie, wie z.B. auf der Ballade „The Town & Miss Loraine“, etwas beliebig und austauschbar.
„The Thread That Keeps Us“ ist eine ausgezeichnete, abwechslungsreiche Songsammlung, die meisten Tracks sind mit knapp unter oder über drei Minuten sehr kurz, wirken damit wie kleine Vignetten, kommen relativ schnell zum Punkt und deklinieren die Calexico-Identität mit Annäherungsversuchen an andere Genres durch – auf „Under the Wheels“ und „Another Space“ wird dem Funk gehuldigt, „Eyes Wide Awake“ klingt schon fast ein bisschen nach den Pixies. „Flores y Tamales“ hingegen ist Calexico by the numbers, das schön melancholische „Thrown to the Wild“ auch, beide funktionieren aber im Albumkontext sehr gut.
Trotz deren Kürze gibt es unter den 15 Songs einige Füller – meist sind akustische Nummern wie „Girl in the Forest“ schuld, da Calexico dort einfach zu sehr auf Nummer sicher gehen. Dem Album steht das Heterogene, das Chaotische allerdings meistens gut, die zusammengewürfelte Stilmischung führt zwar zu keiner radikalen Neuerfindung, die verschiedenen Anleihen sind aber eine willkommene Bereicherung für das Klanguniversum der Band, zumal die Platte nach einem etwas holprigen Mittelteil äußerst stark endet.
Back to the Roots


Long Distance Calling aus Münster gelten zu Recht als eine der besten Postrock-Bands überhaupt. Den Songs ihrer ersten beiden Werke, „Satellite Bay“ und „Avoid the Light“, gelang es, so verdammt einfallsreich und spannend zwischen Postrock-Strukturen und Metal-Anleihen zu variieren, dass einem bei Tracks wie „Black Paper Planes“ auch nach dem 30. Durchlauf noch der Mund offenstehen bleibt – so grandios fließt hier ein tolles Riff ins andere, so perfekt durchdacht sind Aufbau und Struktur. Wem Russian Circles zu melodielos, And So I Watch You From Afar zu hektisch und alle anderen Postrock-Bands zu fade sind, der kommt an Long Distance Calling nicht vorbei. Nach drei fantastischen Alben wagte die Band dann das Experiment und integrierte vermehrt (das klingt jetzt für Leute, die mit Postrock nichts am Hut haben, etwas merkwürdig) Gesangsparts in ihre Songs. Fans und Kritiker waren geteilter Meinung: Das wunderbare Einfallsreichtum der Instrumentalisten wich auf den zwei nächsten Platten leider etwas in den Hintergrund, auch wenn „The Flood Inside“ und „Trips“ durchaus sehr gute Alben waren.
Mit Boundless wollen sich Long Distance Calling auf die frühen Stärken verlassen: acht Tracks, kein Gesang und Songtitel, die allesamt nach der Ferne, der Unendlichkeit des Universums oder dem Erforschen der Weiten unseres Planeten klingen. Um der Spannung sofort ein Ende zu setzen (ein Blick aufs Rating reicht ohnehin): Die Besinnung auf das rein Instrumentale geht voll auf. Schon vor kurzem, auf dem Gloomaar-Festival in Neunkirchen, spielte die Band ausschließlich von ihren drei ersten Werken und man sah ihnen die Spielfreude, die sich bis in die letzte Reihe verbreitete, deutlich an. Das Album wirkt, als hätte sich im Laufe der letzten Scheiben, auf denen sich Long Distance Calling in ein anderes stilistisches Korsett zwängten, eine ganze Menge an Ideen angestaut, die man nun ungezügelt im Studio ausprobiert hätte.
Auf „Boundless“ funktioniert sie wieder einwandfrei, die Band-Alchemie, die bewirkt, dass die Tracks dank ihres Ideenreichtums, des Feingefühls für tolle Melodien und das Schaffen von Atmosphären auf Anhieb eingängig sind wie auch, aus genau den gleichen Gründen, eine Nachhaltigkeit besitzen, die zur Konsequenz hat, dass man einen Song wie den neunminütigen Opener „Out There“ von Anfang an auf Dauerrotation hören möchte: Das perkussive Intro, auf das sich schnell ein knackiges Riff legt, die beiden harmonierenden Gitarren, die im ersten Drittel melodieverliebt wetteifern, das Klavier, das in der Mitte des Tracks Ruhe einkehren lässt, die Gitarren, die das erneute Aufbäumen geduldig mit dem Bass vorbereiten – hier stimmt einfach alles und der Track kann jetzt schon ganz vorne im Bandkanon eingetragen werden.
Auf dem folgenden „Ascending“ wird das Tempo angezogen, auch hier überzeugt die mäandernde Songstruktur genauso wie die starke Rhythmussektion, von harten Riffs bis zu melancholischen Arpeggi findet man hier nicht nur eine Vielfalt an tollen Songpassagen, diese fließen vor allem gekonnt und keinesfalls willkürlich ineinander. LDC prahlen nicht mit ihrer Vielfalt und ihrem Talent, das Voranschreiten der Songs wirkt natürlich, konsequent und zwingend: „In the Clouds“ beginnt schön atmosphärisch, erinnert teilweise an Progrock-Helden wie Porcupine Tree, lässt die Gitarren heulen, bäumt sich dann auf, schiebt erst ein Synthie-Loop dazwischen, dann eine knackige Basslinie. Auf den ersten drei Tracks erlaubt sich die Band nicht den geringsten Fauxpas, in der Folge löst sie sich dann sogar etwas von der strengen „Back to the Roots“-Haltung und leugnet auch nicht den Exkurs in die 80er und den Alternative-Rock vom Vorgänger „Trips“: Die Synthies sind manchmal schön käsig und huldigen den Progbands des vergangenen Jahrtausends (siehe „The Far Side“), „Like a River“ klingt mit Staccato-Riffs, Bläsern und Streichern wie „Knights of Cydonia“ hätte klingen können, wenn Muse halt nicht Muse wären und Matthew Bellamy versierter und bescheidener wäre (und er natürlich, verzeihen Sie, die Schnauze halten würde). „The Far Side“ ist sowohl laut, dissonant und melodieverliebt und hat ein druckvolles Finale, auf „On the Verge“ gibt’s Raum zum Aufatmen, bevor Klavier, Bass und Schlagzeug ein verdammt eingängiges Finale einläuten. „Weightless“ und „Skydivers“ beenden das Album wunderbar.
Die Songs auf „Boundless“ sind teilweise kompakter als auf den ersten drei Alben und damit weniger episch, nicht jeder Track zündet gleichermaßen und an Übersongs wie „Black Paper Planes“ oder „Into the Great Wide Open“ kommt nicht jedes der acht Stücke heran, dafür hört man sich die Platte am besten in einem Durchlauf (und dann immer wieder) an – und genießt 48 Minuten anspruchsvolle, clevere, eingängige instrumentale Musik. Nach Luxemburg kommt die Band diesmal leider nicht, aber Saarbrücken ist nicht weit weg – denn live sollte man diese unverschämt talentierte Band unbedingt erlebt haben.
Virtuoser Minimalismus


Letzte Woche erschien sein neues Album All Melody kurz vor seinem Auftritt in einer ausverkauften Philharmonie, seitdem tourt Nils Frahm damit ausgiebig in unseren Nachbarländern. Wir haben die verstrichene Woche genutzt, um uns das neue, fantastische Solowerk des Pianisten im Detail anzuhören – und kamen anfangs kaum dazu, uns die anderen diese Woche veröffentlichten Scheiben anzuhören, so sehr hat das Werk uns in seinen Bann gezogen.
Das Opener-Duo „The Whole Universe Wants to Be Touched/Sunson“ setzt ziemlich präzise das Paradigma für diese Platte, auf der das Organische und das Elektronische nicht nur nahtlos miteinander verknüpft werden: Die Dichotomie zwischen analog und digital erscheint hier irgendwann sinnlos. So eröffnet das Album mit einem Chor und Orgelklängen, die irgendwann melancholisch-bedrohlich in der Luft hängen, bevor mit dem grandiosen „Sunson“ ein tanzbarer Beat aufkommt, wie ihn viele waschechte Mainstream-Elektro-Artisten nicht hinkriegen. Panflöten ertönen allmählich und man merkt eigentlich, wie egal es für den Song jetzt ist (nichts gegen die Panflötler dieser Erde), ob der Sound jetzt aus dem Synthie kommt oder „echt“ eingespielt wurde: Frahm schafft sich hier eine Klangwelt, die er mit einer fast manischen Präzision kontrolliert, der rhythmische Rahmen bietet ihm dann aber einen unglaublichen künstlerischen Freiraum, auf dem Frahm dann zwischen Improvisation und durchstrukturierten Melodien pendelt. Auf den epischsten Tracks der Scheibe wiederholt Frahm diesen Prozess jedes Mal so gekonnt, dass zu keinem Zeitpunkt ein Wiederholungseffekt auftaucht. Im Gegensatz zum Vorgänger „Solo“ ist „All Melody“ auch abwechslungsreicher und zeigt die zahlreichen Facetten des Musikers Frahm: Es gibt die langen Elektro-Tracks, die langsamen Klavierballaden, die zwischen Minimalismus und Virtuosität pendeln („My Friend the Forest“, „Forever Changeless“) und die Ambient-Tracks, die eine wahrhaft melancholische Stimmung verbreiten („#2“). Frahm arbeitet sich an allem ab, was Tasten und Regler hat. Der Minimalismus wird hier nie zur Leere, die Virtuosität nie zur Prahlerei –Frahms Talent steht stets im Dienst des Songs. Wer das Konzert in der Philharmonie verpasst hat, sollte sich das Album unbedingt zulegen.

 De Maart
De Maart









Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können