15. November 2025 - 9.51 Uhr
Tagung zu KI und KulturÜber den Schlachtplan der Luxemburger Regierung und den Pessimismus des Künstlers Filip Markiewicz

Das plant die Politik
„Künstliche Intelligenz [KI, d.Red.] ist keine Zukunftsmusik“, sagte Kulturminister Eric Thill (DP). „Sie ist spürbar dabei, den kulturellen Raum und unseren Berufsalltag zu verändern.“ Mit diesen Worten eröffnete er am Mittwoch die Tagung zu Kultur und KI im Creative Hub 1535 in Differdingen. Der Andrang war groß. Rund 200 Menschen waren vor Ort, schreibt das Kulturministerium. Das Publikum bestand aus Verbands- und Institutionsmitgliedern, Kulturschaffenden, Kreativunternehmen. Was ihnen zuerst geboten wurde? Ein Blick auf Luxemburgs KI-Strategie.
Luxemburg reagiere auf die rasanten Entwicklungen im KI-Bereich, versicherte Thill. 2024 gründete das Kulturministerium eine entsprechende Arbeitsgruppe. Das Ziel: eine erste Kartografie über den Einfluss von KI auf den Kulturbereich erarbeiten. Die Ergebnisse flossen in die nationale Strategie „Accelerating digital sovereignty 2030“ der Regierung ein, die im Mai veröffentlicht wurde. Der Kultursektor nimmt darin ein Kapitel ein („Culture: enablers of integration, creativity, and inclusion“). Im Mittelpunkt stehen unter anderem der Urheberschutz, Inklusion durch KI und Bildung. Die Strategie ist online verfügbar.

Genauso wie das „White Paper“ „Culture et IA“ des Kulturministeriums, das Thill bei der Tagung präsentierte. Das Redaktionsteam (Alessandra Luciano, Cédric Kayser und Janina Strötgen) analysiert darin die Auswirkung der KI auf den Kultursektor. Vom Einfluss auf die Kreativschaffenden bis hin zum ökologischen Fußabdruck der Datenzentren. Am Ende des Dokuments: zwölf Empfehlungen bzw. Aktionspunkte, im Einklang mit der nationalen KI-Strategie. Die Abgeordnetenkammer werde in die Ausarbeitung eingebunden, so Thill. „Heute Morgen habe ich einen Antrag an Kommissionspräsident André Bauler gestellt, um das ‚White Paper’ in der Kulturkommission vorzustellen.“
Der Mensch solle jedoch das Zentrum der Kultur bleiben, unterstrich Thill. Das Urheberrecht gehöre durch klare Gesetzesvorschriften bewahrt; Institutionen sollten nicht nur zu Nutzenden von KI verdammt, sondern als Partnerinnen einer vertrauenswürdigen Datenökonomie anerkannt werden. „Daten dürfen nicht ohne Zustimmung genutzt werden, um KI-Plattformen zu trainieren“, mahnte Thill des Weiteren. Nationale Souveränität und Transparenz gegenüber der Bevölkerung seien ihm wichtig.
Neben den Risiken ging Thill auch auf den Mehrwert von KI ein. Sie könne Barrieren abbauen – etwa durch automatische Bildbeschreibungen oder Übersetzungen. „Sie kann ein Instrument der Inklusion und der kulturellen Beteiligung sein“, sagte er. Ein spezielles Augenmerk legte er zudem auf die Mehrsprachigkeit: „Luxemburg ist ein mehrsprachiges Land. Wir streben an, die luxemburgische Sprache aktiv in KI-Plattformen zu integrieren.“
Ferner sprach er den energetischen Kostenpunkt der KI und der Datenzentren an. „Sie verbrauchen Ressourcen und hinterlassen einen CO₂-Fußabdruck“, warnte er. Eine zukunftsorientierte Kulturpolitik müsse dem Rechnung tragen. Neben technologischen und legislativen Projekten setzte das Ministerium zudem auf Bildung. Dazu diene unter anderem das Weiterbildungszentrum „Digital Learning Hub“. Die Tagung verstehe er als Startpunkt für einen weiterführenden Austausch mit dem Sektor.
Das sagt die Branche
Auf Thills Rede folgten ein Vortrag des Kunsttheoretikers Klaus Speidel, eine Kunstperformance von Andrea Mancini, zwei Rundtischgespräche („Création à l’ère de l’IA: repenser la chaîne de valeur“/„Patrimoine numérique: enjeux, usages et perspectives“) und Ateliers. In Erinnerung blieb vor allem die Debatte um Kreation im Zeitalter der KI. Wer sich beteiligte: die Künstler*innen Sophie Langevin (Regisseurin, Schauspielerin, Performerin) und Filip Markiewicz (multidisziplinärer Künstler), der Direktor der Verwertungsgesellschaft Sacem, Marc Nickts, sowie die Expertin für Digitalpolitik des „Service des médias“ der Regierung, Stéphanie Silvestri. Die Moderation übernahm Cédric Kayser vom Kulturministerium.
Pessimismus
Markiewicz outete sich früh als Pessimist, besonders im Hinblick auf eine kontrollierbare Entwicklung der KI. Der Künstler greift selbst auf KI zurück, bindet sie in Ausstellungsprozesse oder in die Kostümgestaltung ein. „Die Besucher erleben so eine hybride Realität“, meint er. Woher rührt also die KI-Skepsis? Er steht der Wirksamkeit bestehender Gesetze und Strategien kritisch gegenüber. Der Künstler lobte den menschenzentrierten Ansatz der Luxemburger Regierung, aber: „Europa hinkt hinterher, China und die USA sind Vorreiter.“ Er führte den Einfluss großer Tech-Firmen an. „Luxemburg kann so viele Gesetze ausarbeiten, wie es will – das verhindert nicht, dass Spotify KI-generierte Musik vertreibt.“

Sophie Langevin schlug ähnliche Töne an. 2020 präsentierte sie, zusammen mit dem Theaterschaffenden Ian De Toffoli, das Stück „App Human“. Das Duo befasst sich darin – grob zusammengefasst – mit dem Einfluss der KI auf die Menschheit und die Weltordnung. Eine Aufzeichnung ist kostenfrei auf theatredeliege.be verfügbar. „Die KI entwickelt sich seitdem beängstigend schnell weiter“, hielt Langevin fest. „Das wirft die Frage nach dem freien Willen und den Rechten von Schauspielenden auf, insbesondere im Hinblick auf die unerlaubte Nutzung ihrer Bilder.“ Die existierenden Regulierungen seien noch zu schwach.
Unbehagen drückte auch Marc Nickts aus. Er sorgt sich um die Rechte der Musikschaffenden. „Wir kämpfen seit 2023 gegen die Nutzung der Werke, die wir vertreten“, sagte er. „Jetzt stehen erste Gerichtsprozesse wegen Verstößen an.“ Nickts verwies auf Zahlen des Streamingdienstes Deezer. Eine eigene Recherche ergibt: Deezer vermeldete kürzlich den Upload von 50.000 KI-generierten Tracks am Tag. Kompositionen, die oft auf Basis bestehender Songs entstehen. Ohne die Erlaubnis der Urheber*innen. Das macht 34 Prozent des Angebots aus. Ein Wert, der in nur acht Wochen um sechs Prozent stieg.
Hoffnungsschimmer?
Stéphanie Silvestri kam derweil erneut auf die Luxemburger Politik zu sprechen. Die Regierung bemühe sich, die Entwicklungen im KI-Bereich interministeriell zu begleiten. Es brauche Synergien, gemeinsame Lösungsansätze. Die nationale KI-Strategie basiere auf ethischen Prinzipien und dem europäischen KI-Gesetz. „Wir wollen Luxemburg als digitalen ‚hub‘ stärken“, so Silvestri weiter. Die Politik setze auf vertrauenswürdige, nachhaltige, transparente Modelle – und auf die Bildung im Umgang mit KI.
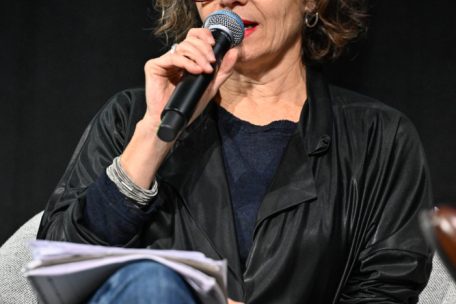
Argumente, die Markiewicz kalt ließen. „Ich sehe das ‚big picture‘. Ich fürchte mich nicht vor der KI, sondern vor den Menschen“, unterstrich der Künstler. Er holte weiter aus, übte Kritik an der gesellschaftlichen Anpassung an die Vorgaben der Tech-Giganten. Langevin pflichtete ihm später bei: „Wir sind komplett im Universum der Maschinen gefangen, die uns diktieren, wie wir leben, was wir essen – das geht über unsere Bedürfnisse hinaus.“
Markiewicz kam auf Luxemburgs und Europas Handlungsmacht zurück. „Luxemburgs Premierminister setzte kürzlich die Tech-Firmen in Amerika ‚en valeur’. Gut für die Wirtschaft, aber: Was ist mit Luxemburg, mit Europa? Wir müssen uns intensiver mit unserer eigenen Realität befassen, die unvergleichbar mit der aus dem Ausland ist.“
Nickts lehnte eine fatalistische Haltung ab. Er erkannte die Herausforderungen, prangerte die Unzulänglichkeiten des europäischen KI-Gesetzes sogar offen an. Aufgeben sei jedoch keine Lösung. Der Schlüssel zum Erfolg für ihn – Transparenz. Es brauche stärkere Verordnungen, verbindliche Chartas und neue Initiativen. „Die KI hat einen Nutzen für die Kreativbranche: Viele Kunstschaffende, die wir vertreten, greifen darauf zurück. Wenn die Rechte aller Beteiligten respektiert und die Datensets, mit denen die Programme gefüttert werden, dahingehend ‚clean‘ sind, ist das ein wundervolles Zusammenspiel.“
Überzeugte das Markiewicz? Nein, er beharrte auf seiner Position: „Ich bleibe pessimistisch, weil unsere Welt sich politisch in die falsche Richtung bewegt. Auch wenn ich das Zeitalter, in dem wir leben, und die Tools spannend finde. Das Risiko besteht, dass wir in eine blinde Leidenschaft verfallen.“
Anmerkung: KI wird in diesem Artikel als Sammelbegriff benutzt.

 De Maart
De Maart






Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können