„Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung.“ Der Aphorismus stammte von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), dem Naturwissenschaftler, Schriftsteller und Meister der geistreichen Sinnsprüche. Die ersten indigenen Amerikaner, die Kolumbus sahen und in Kontakt mit Europäern kamen, waren die Arawak auf den Antillen. „Sie bieten jedem an, ihre Güter zu teilen“, schrieb Kolumbus nach der Begegnung mit ihnen in sein Logbuch. Der Genuese in spanischen Diensten brachte einige von ihnen nach Spanien. Ihr Volk wurde ausgerottet.
Im ersten Kapitel seines Buches „Eine Geschichte des amerikanischen Volkes“ hat sich Howard Zinn des Themas angenommen. Der US-Historiker beschreibt, wie Kolumbus auf die gastfreundlichen Indigenen traf. Getrieben von der Suche nach Gold, unterwarfen die Spanier die „Native Americans“, wie die Indigenen in Zinns Buch auch in der deutschen Übersetzung genannt werden. Die Indigenen wurden Opfer von Gewalt und Versklavung, von Ausbeutung und Krankheiten, die die Europäer einschleppten.
Eine andere Perspektive
Howard Zinn zitiert den jungen Priester Bartholomé de Las Casas (1484-1566), der an der Eroberung Kubas teilnahm und zum vehementen Kritiker der spanischen Grausamkeiten wurde. Las Casas transkribierte Kolumbus’ Aufzeichnungen und schrieb eine mehrbändige „Geschichte der Westindischen Länder“. So wurde er zu einem Vorläufer, der in „A People’s History of the United States“, so der Originaltitel von Zinns monumentalem Werk, mit der bisherigen romantisierenden Sicht auf Kolumbus brach, indem er das Leiden der indigenen Völker hervorhob. Zinn betonte die Notwendigkeit einer anderen Perspektive der Geschichtsschreibung, jener der Unterdrückten.
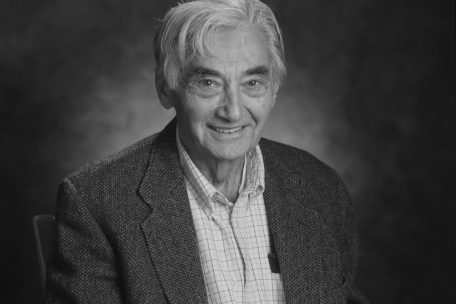
Zinn schildert in dem Kapitel „Kolumbus, die Native Americans und der Fortschritt der Menschheit“ die systematische Ausrottung und Vertreibung der Ureinwohner, die mit der Kolonialisierung einhergeht. Er beschreibt die komplexen Sozialstrukturen der Indigenen und widerlegt ihre angebliche Minderwertigkeit. „Eine Geschichte des amerikanischen Volkes“ ist nicht nur sein bekanntestes Werk, sondern ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnliches. In dem erstmals 1980 erschienenen, gut 900 Seiten umfassenden Buch, das erstmals 2007 in deutscher Übersetzung veröffentlich wurde, erzählt der Historiker die US-Geschichte aus der Perspektive fernab des Establishments: aus der Sicht von Indigenen, Sklaven und Arbeitern, aber auch aus der von Frauen – all jener, die sich ihre Rechte erst erkämpfen mussten.
Ausführlich setzt sich der Autor mit dem Rassismus in den USA auseinander: „Nirgends auf der Welt hat Rassismus über einen so langen Zeitraum eine so wichtige Rolle gespielt wie in den Vereinigten Staaten“, schreibt er im zweiten Kapitel über „Die Entstehung der Segregation“. Das Problem der „color line“ – Zinn nimmt mit diesem Begriff Bezug auf den Historiker, Journalisten und Bürgerrechtler W.E.B. Du Bois (1868-1963) – bestehe nach wie vor. Die Frage, „ob ein Zusammenleben von Schwarzen und Weißen ohne Hass möglich ist“, sei daher mehr als eine rein historische.
Im sechsten Kapitel des Buches heißt es: „Es ist möglich, die Hälfte der Bevölkerung zu vergessen, wenn man traditionelle Geschichtsbücher liest. Die Entdecker waren Männer; die Grundbesitzer und Kaufleute: Männer; die politischen Führer: Männer; die militärischen Persönlichkeiten: Männer. Die regelrechte Unsichtbarkeit von Frauen, das Übersehen der Frauen, zeigt ihren verschütteten Zustand.“ Die Liste von Missständen, unter denen die weibliche Bevölkerung zu leiden hatte, ist lang: kein Wahlrecht, kein Recht auf Lohn oder Eigentum, keine Rechte in Scheidungsfällen, keine gleichen Chancen auf Anstellung, keine Hochschulzulassung. Erst ab den 1830er Jahren begannen sich Frauen gegen Versuche zu wehren, sie in ihrer „weiblichen Sphäre“ festzuhalten. Ihr Kampf dauerte lang und war erfolgreich. Doch der politische und gesellschaftliche Backlash von heute und der von US-Präsident Donald Trump und seiner MAGA-Bewegung geführte Kulturkampf stellen auch diese Errungenschaften in Frage.
Von der Kleinauflage zum Bestseller
Zuerst in kleiner Auflage publiziert, wurde das Hauptwerk des Historikers im Lauf der Zeit zum Bestseller und der Verkauf des millionsten Exemplars 2003 gefeiert. Dabei waren Zinns Startbedingungen alles andere als einfach. 1922 in New York geboren, wuchs er in einer jüdischen Arbeiterfamilie in Brooklyn auf und arbeitete dort als Schiffsschlosser auf der Werft. Im Zweiten Weltkrieg nahm er an Einsätzen der US-Luftwaffe in Europa teil und erlebte im April 1945 die Bombardierung mit Napalm der noch von der deutschen Wehrmacht besetzten Stadt Royan an der französischen Atlantikküste, was seine Ablehnung von Krieg im Allgemeinen prägte. Obwohl Zinn im Kampf gegen den Faschismus einen moralischen Sinn sah, waren die Kriegserlebnisse maßgeblich für seinen Pazifismus.
Nach dem Krieg studierte Zinn mit einem GI-Stipendium Geschichte mit dem Nebenfach Politikwissenschaft an der New York City University und danach an der Columbia University, wo er 1958 promovierte. In seiner Dissertation befasste er sich mit der Karriere von Fiorello La Guardia, des früheren Bürgermeisters seiner Heimatstadt. Von 1956 bis 1963 unterrichtete Zinn in der Abteilung für Geschichte und Sozialwissenschaften des Spelman College in Atlanta, wo er zudem in der Bürgerrechtsbewegung aktiv wurde. Nachdem er wegen seiner Unterstützung für protestierende Studenten entlassen worden war, wechselte Zinn an die Boston University, wo er bis zur Pensionierung im Jahr 1988 lehrte. Er schrieb unter anderem über die Bürgerrechtsbewegung, die Anti-Kriegsbewegung und die Geschichte der Arbeiterbewegung in den USA. Der Titel seiner Memoiren, „You can’t be neutral on a moving train” (1994), war bezeichnend für ihn. So hieß auch ein Dokumentarfilm über sein Leben und Werk aus dem Jahr 2004. Zinn starb 2010 im Alter von 87 Jahren.
Es gibt keine objektive Geschichte
Die Zeit der Bürgerrechtsbewegung nannte er später „wahrscheinlich die interessantesten, aufregendsten Jahre“. Er habe dabei mehr von seinen Studentinnen gelernt als sie von ihm. Unter anderem arbeitete er mit der späteren Pulitzer-Preisträgerin Alice Walker („Die Farbe Lila“) und mit der Kinderrechtsaktivistin Marian Wright Edelman zusammen, deren Mentor er wurde. „Es gibt keine objektive Geschichte“, lautete Zinns Einsicht. „Es gibt nur eine Geschichte, die erzählt wird, und sie wird von denen erzählt, die Macht haben.“ Im Gegensatz zur etablierten Geschichtsschreibung in den USA analysierte Zinn die Geschichte „von unten“ – nicht aus der Perspektive der Mächtigen, sondern aus der Sicht der Ausgebeuteten, Marginalisierten und Unterdrückten, was ihm den Namen „The People’s Historian“ einbrachte.
Revolutionärer Ansatz
Die Besonderheit von Zinns Arbeiten war nicht nur sein „bottom-up“-Ansatz, wie sein deutscher Kollege Norbert Finzsch, der frühere stellvertretende Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Washington, im Vorwort zur aktuellen Ausgabe anmerkt, sondern in dem lebhaften Stil und erzählerischen Rhythmus, der durch die Übersetzerin Sonja Bonin vortrefflich ins Deutsche übertragen wurde. Zinn sei nicht akademisch neutral gewesen, sondern habe sich mit den Unterdrückten identifiziert, betont Finzsch. „Eine Geschichte des amerikanischen Volkes“ reicht bis zur Ära von George W. Bush, dessen Sieg in der Wahl gegen Al Gore, die sich „als die bizarrste in der Geschichte des Landes“ herausstellte, und in Bushs „Krieg gegen den Terrorismus“ mündete.

Statt sich auf die glorreichen Momente zu fokussieren, nennt Zinn die düsteren Seiten und die strukturelle Ungerechtigkeit, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der USA zieht. Er weist darauf hin, dass eine riesige Zahl von Amerikanern vom Reichtum ausgeschlossen sind. Seine Schilderungen verdeutlichen, warum die US-Gesellschaft heute so tief gespalten ist. Zinn kritisiert aber auch Washingtons Außenpolitik im Kapitel „Das Imperium und das Volk“ über den philippinisch-amerikanischen Kolonialkrieg von 1899 bis 1902, in dessen Folge Hunderttausende Philippinos an Cholera starben. Der fast schon in Vergessenheit geratene Krieg wird von manchen Experten als Genozid durch die Kolonialmacht USA bezeichnet. Auch den Vietnamkrieg sieht Zinn als Zeugnis kolonialer Politik. Er benennt das Massaker von My Lai 1968 und die Flächenbombardements von Vietnam und Kambodscha als Kriegsverbrechen. Durch sein Engagement gegen den Vietnamkrieg geriet Zinn ins Visier des FBI.
„Eine Geschichte des amerikanischen Volkes“ überzeugt nicht zuletzt durch Faktenreichtum, auch wenn sich kleinere sachliche Fehler einschlichen, zum anderen wühlt das Buch auf. Einige prominente Historiker empörten sich und nannten Zinn „einseitig und einfältig“. Norbert Finzsch kommt im Vorwort auf das Zinn-Bashing zu sprechen. Der Erfolg bei der Leserschaft gab dem US-Historiker mit seiner antikapitalistischen, antirassistischen und pazifistischen Haltung recht. Für seine Studenten war es eine „erste Begegnung mit der neuen Sozialgeschichte“. Sein historischer Ansatz war durchaus revolutionär – und alles andere als im Sinne einer „Erinnerung von Staaten“, wie der frühere US-Außenminister Henry Kissinger die Geschichte einmal nannte.
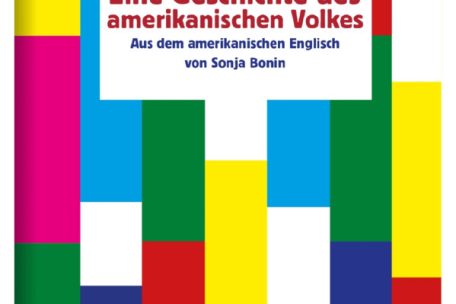
Howard Zinn: Eine Geschichte des amerikanischen Volkes. Aus dem Englischen von Sonja Bonin. März Verlag 2025. 927 Seiten. 48 Euro

 De Maart
De Maart









Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können