Wenn in Vanuatu das Meer bei Flut bis an die Wurzeln der Mangroven schwappt und Kinder nur noch bei Ebbe am Strand Fußball spielen können, wirkt der Klimawandel nicht wie eine ferne Warnung, sondern wie ein täglicher Begleiter. Auch auf den Nachbarinseln im Pazifik berichten Bewohner von salzigem Brunnenwasser, versandeten Gärten und Wegen, die nach jeder Regenzeit neu angelegt werden müssen. Für viele Gemeinschaften in der Region ist die Klimakrise längst keine abstrakte Zukunftsgefahr mehr – sie verändert schon heute ihren Alltag, ihre Lebensgrundlagen und ihre Heimat.
Jetzt steht eine juristische Entscheidung bevor, die die globale Klimapolitik verändern könnte: In den kommenden Monaten wird der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag ein Gutachten vorlegen, das die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Staaten im Kampf gegen den Klimawandel klären soll.
„Wir stehen an vorderster Front einer Krise, die wir nicht verursacht haben“, sagt Ralph Regenvanu, Klimaminister von Vanuatu, einem winzigen Inselstaat, rund 1.750 Kilometer östlich von Australien. Sein Land hat das IGH-Gutachten angestoßen – mit Unterstützung von 132 Staaten und unter maßgeblicher Beteiligung pazifischer Jugendlicher. Der IGH soll beantworten, wie viel Verantwortung große Emittenten gegenüber verletzlichen Staaten wie Vanuatu tragen – und welche Konsequenzen bei Untätigkeit drohen.
Idee aus dem Klassenzimmer
Begonnen hatte die Initiative 2019 in einem Klassenzimmer auf Vanuatu. „Für uns als Jugendliche aus den am stärksten betroffenen Regionen ist das Gutachten nicht nur ein juristisches Dokument“, sagt Vishal Prasad, Direktor der Organisation Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC). „Es ist eine Chance, das Machtverhältnis zu verändern.“ Zu lange sei Klimagerechtigkeit nur als moralischer Appell betrachtet worden. „Jetzt wird sie durch rechtliche Klarheit untermauert.“ Die Idee der jungen Pazifikbewohner gewann schnell internationale Unterstützung – und mündete 2023 in einer wegweisenden Resolution der UN-Generalversammlung.
Die Abstimmung war ein symbolischer Sieg für den globalen Süden – und ein juristischer Meilenstein. „Die Resolution bittet den IGH, zu klären, welche rechtlichen Verpflichtungen Staaten haben, um Klima und Umwelt zu schützen – und was passiert, wenn sie diese verletzen“, erklärt die Völkerrechtlerin Margaretha Wewerinke-Singh, die Vanuatu juristisch berät. Zwar ist das Gutachten nicht rechtsverbindlich, doch es kann internationale Normen prägen und Druck auf große Emittenten wie die EU, China oder die USA erhöhen. Laut Wewerinke-Singh könne es „ein Wendepunkt sein – aber nur, wenn wir ihn auch nutzen“.
Eine existentielle Bedrohung
Für Vanuatu, das regelmäßig von Zyklonen heimgesucht wird, ist der Kampf gegen den Klimawandel ein Überlebenskampf. 2015 verwüstete Zyklon Pam weite Teile des Inselstaats und verursachte Schäden in Höhe von fast 450 Millionen US-Dollar – mehr als 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 2023 trafen dann zwei weitere schwere Wirbelstürme kurz hintereinander auf das Land. Einige Inseln ragen oft nur wenige Meter aus dem Ozean. Jeder Zentimeter Meeresspiegelanstieg ist eine Bedrohung für ihre Existenz. Die rund 300.000 Bewohner leiden nicht nur unter den physischen Schäden, sondern auch unter dem Verlust von Lebensgrundlagen: Landwirtschaft, Fischerei und Tourismus – die wichtigsten Wirtschaftszweige – sind massiv vom Wetter abhängig.
Das Recht scheint die Wissenschaft langsam einzuholen – die Frage ist nun, ob die Politik dem Recht folgt
Gleichzeitig zählt das gerade 12.000 Quadratkilometer große Vanuatu zu den wenigen Ländern der Welt, die mehr CO₂ absorbieren, als sie ausstoßen. Schon heute ist der Inselstaat CO₂-negativ – und hat sich verpflichtet, bis 2030 die Stromerzeugung vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Fossile Brennstoffe sollen fast komplett abgeschafft werden.
Appell an die Industriestaaten
Das Gutachten des IGH könnte – auch wenn es rechtlich nicht bindend ist – den Ton der Klimadiplomatie grundlegend verändern und laut Wewerinke-Singh entscheidend zur Durchsetzung internationaler Klimarechte beitragen. „Das Recht scheint die Wissenschaft langsam einzuholen – die Frage ist nun, ob die Politik dem Recht folgt“, sagt die Rechtsexpertin. Doch sollte das Gutachten deutlich machen, dass Untätigkeit beim Klimaschutz völkerrechtswidrig ist, so könnte dies Klagen gegen Staaten mit unzureichender Klimapolitik stärken und neue Instrumente wie globale Entschädigungsfonds auf den Weg bringen.
Minister Regenvanu fordert nun konkrete Taten – besonders von Industriestaaten wie Japan und Australien. Während Japan rund drei Prozent der globalen Emissionen verursacht, kommen alle Pazifikinseln zusammen auf nur 0,02 Prozent. Trotzdem sind sie überproportional betroffen. Von Australien dagegen erwarten die Pazifikstaaten den Verzicht auf neue fossile Projekte. Auch an Europa richtet sich der Appell. Das Gutachten müsse in internationale Verhandlungen wie die UN-Ozeankonferenz und die COP30 in Brasilien eingebettet werden. Dort solle ein gerechter Übergangsplan für die Pazifikregion auf den Weg gebracht werden – mit dem Ziel, bis 2050 vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen.
Regenvanu fordert zudem einen fairen Klimafinanzierungsmechanismus: Eine Steuer auf Klimaschäden oder Abgaben auf den internationalen Schiffsverkehr könnten helfen, Emissionen zu senken und betroffene Regionen zu unterstützen. „Dies ist ein entscheidender Moment für die Menschheit – unsere Reaktion heute wird über Generationen hinweg nachhallen“, so der Minister.

 De Maart
De Maart

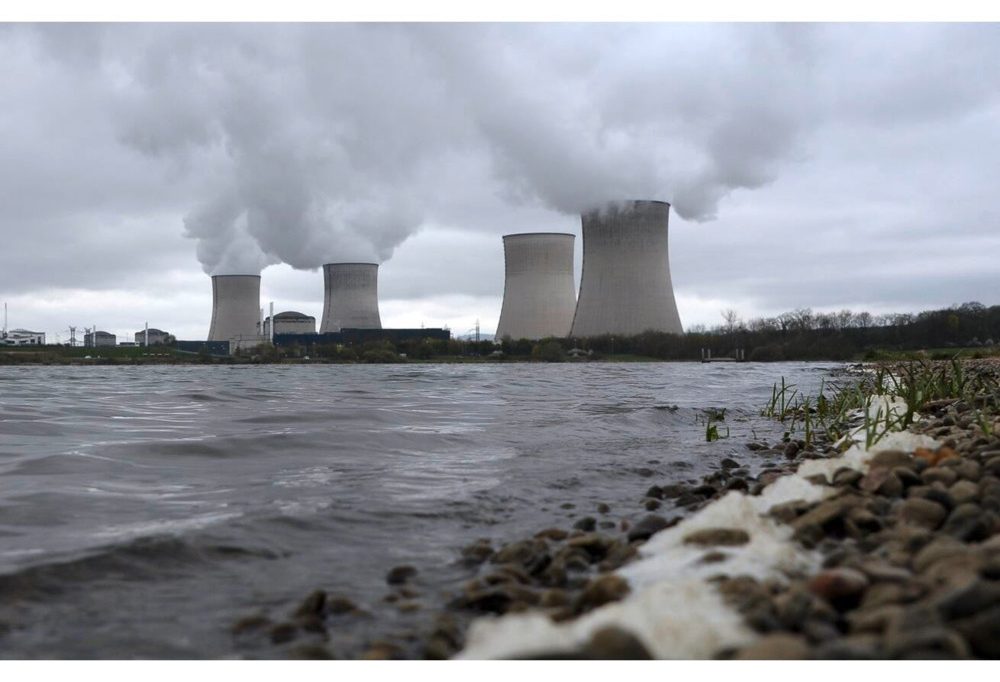





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können