Moskau während der Stalin-Zeit: Trotz seines Bekanntheitsgrades wird ein Schriftsteller aus dem sowjetischen Schriftstellerverband ausgeschlossen, die Inszenierung seines jüngsten Theaterstücks über Pontius Pilatus wird aus ideologischen Gründen abgesagt, sein Verleger distanziert sich öffentlich von ihm und sein Freund Aloisius entpuppt sich als Verräter. Da lernt er Margarita kennen, die unglücklich mit einem hohen Funktionär verheiratet ist und seine Geliebte wird. Sie nennt den Schriftsteller „Meister“. Inspiriert von seiner Muse, beginnt dieser, einen Roman zu schreiben.
Ein Deutscher namens Woland besucht Moskau. Der mysteriöse „Professor für schwarze Magie“ ist der leibhaftige Satan. An seiner Seit hat der Fremde eine bizarre Entourage um den sprechenden Kater Behemoth. Woland rächt sich an all jenen, die den „Meister“ zu Fall gebracht haben. Während der Autor immer tiefer in seinen Roman eintaucht und sich und Margarita als Figuren hinzufügt, erkennt er allmählich immer mehr, dass das Geschehen immer groteskere Züge annimmt und die Grenze zwischen Realität und Fantasie verschwindet. Der „Meister“ landet in einer psychiatrischen Klinik. Derweil ist Margarita bereit, die Gastgeberin auf dem Ball des Teufels zu spielen. Zur Belohnung darf sie ihren Geliebten wiedersehen. Sein Buch „Meister und Margarita“ wird vor dem Vergessenwerden gerettet.
Der Roman als satirische Parabel
Der Roman spielt sich auf drei unterschiedlichen Ebenen ab: der Moskauer Gegenwart, die ein demoralisiertes Bild abgibt; der überzeitlichen Parallelwelt des Übersinnlichen, in der sich Woland und sein Gefolge tummeln; der vergangenen Welt des alten Jerusalem. Das literarische Hauptwerk von Michail Bulgakow ist eine fantastische Abenteuergeschichte und Zeitsatire in einem. Der Roman dient als eine philosophische Parabel über Gut und Böse, über menschliche Schwächen sowie die Auswirkungen von Unfreiheit und Unterdrückung, er prangert die Willkür in der Bürokratie an, handelt vom sowjetischen Überwachungsstaat sowie von der Ohnmacht des Künstlers und der Entlarvung der Lüge in der Kunst und im Leben.
Der 1891 in Kiew geborene Schriftsteller und Arzt Bulgakow, der in seiner Heimatstadt Medizin studierte, wurde nach seinem Studium als Chirurg im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Während des Bürgerkriegs 1918 bis 1921 war er Militärarzt bei der ukrainischen republikanischen Armee, der Roten Armee und den Weißgardisten. Ab 1921 lebte er als Autor in Moskau. An „Der Meister und Margarita“ schrieb er ab Ende der 20er-Jahre. Die letzte Fassung diktierte er seiner Frau Jelena kurz vor seinem Tod im März 1940. In diese Zeit fiel auch die Hochphase der stalinistischen Säuberungspolitik. Das Buch erschien erst im November 1966 in einer um rund ein Achtel gekürzten Fassung, als Fortsetzungsroman in der Literaturzeitschrift Moskwa. Heute zählt es zu den wichtigsten Werken der russischen Literatur. 1973 erschien erstmals eine vollständige Ausgabe, zahlreiche Theater-, Oper- und Filmadaptionen folgten. Von den Bühnenfassungen ist besonders „The Master and Margarita“ von Simon McBurney zu nennen. Das Multimedia-Spektakel wurde im Dezember 2011 im hauptstädtischen Grand Théâtre und 2012 beim Theaterfestival von Avignon gezeigt.

Unter den bisherigen Verfilmungen – darunter eine zehnteilige Fernsehserie – ragt Michael Lockshins neue Version heraus. Das Projekt, bei dem ursprünglich Nikolai Lebedew Regie führen sollte, war seit 2018 bekannt, zog sich jedoch so lange hin, dass Lebedew ausstieg. Für ihn übernahm der 1981 in den USA geborene Lockshin, der Ende der 80er-Jahre mit seinen aus Russland stammenden Eltern in die Sowjetunion emigriert war. Dieser studierte in Moskau und arbeitete unter anderem in London als Werbefilmer. Sein bei Netflix erschienenes Spielfilmdebüt „Silver Skates“ über einen Schlittschuhkurier, der sich im Sankt Petersburg der Jahrhundertwende in die Tochter einer adeligen Familie verliebt, versank in kitschigen Klischees. Für „Der Meister und Margarita“ schrieb Lockshin zusammen mit Roman Kantor das Drehbuch neu und verknüpfte den Roman mit dem Leben Bulgakows. Die Dreharbeiten fanden vom Juli bis Oktober 2021 unter anderem in Moskau und Sankt Petersburg statt. Universal Pictures stieg wegen der russischen Invasion in die Ukraine aus, was zu Problemen bei der Postproduktion führte. Zudem wurde aus dem bisherigen Titel „Woland“ schließlich „Der Meister und Margarita“.
Der Start des Films wurde mehrmals verschoben. Er kam schließlich am 25. Januar 2024 in die russischen Kinos und schaffte es zum umsatzstärksten Film, der jemals in Russland gezeigt wurde – bis zum zweiten Wochenende hatte der Film eine Milliarde Rubel eingespielt, in nur einer Woche waren 1,5 Millionen Menschen in die Kinos geströmt. Zudem erhielt der Film teils überschwängliche Kritiken wegen der herausragenden schauspielerischen Leistungen von August Diehl als Woland, Jewgeni Zyganow als „Meister“ und Julia Snigir als Margarita – und wegen seiner visuellen Ästhetik. Dagegen verunglimpften Nationalisten und Putin-Anhänger die Antikriegshaltung des Regisseurs, der seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wieder in den USA lebt, und beschimpften ihn als „Volksfeind“. Empörte Proteste gab es wegen der regimekritischen und antitotalitären Stoßrichtung des Films. Die Gegner forderten gar eine strafrechtliche Untersuchung. Chefpropagandist Wladimir Solowjew hetzte über das „antisowjetische, antirussische Thema“. Kritisiert wurde auch, dass die insgesamt 17 Millionen US-Dollar teure Produktion vom russischen Filmfonds gefördert worden war.
Wir wollten einen Film machen, der zwar in der Vergangenheit angesiedelt ist, aber heute aktuell ist
Die auf verschiedenen Zeitebenen und mit Rückblenden erzählte Handlung offenbart einige Parallelen zum autokratischen Regime Wladimir Putins. Regisseur Lockshin sagte dazu: „Wir wollten einen Film machen, der zwar in der Vergangenheit angesiedelt ist, aber heute aktuell ist. Trauriger- und tragischerweise wurde unsere Geschichte plötzlich blanke Gegenwart.“ Aus der surrealistischen Fantasy-Parabel über Stalins Totalitarismus wurde eine Geschichte über den russischen Alltag von heute. In dem brillant bebilderten Streifen wechseln realistische Passagen aus dem Moskau der beschriebenen Dekade mit Szenen aus dem verbotenen Theaterstück des Autors und Gesprächen in einer futuristisch wirkenden psychiatrischen Anstalt, in der der „Meister“ festgehalten wird, aber heimlich sein Buch zu Ende schreibt.
Entlarvung des Totalitarismus
Ist der Film wirklich der Komplexität des Romans gerecht geworden? Zumindest ist er ein visuelles Spektakel, das leider vor allem in der letzten halben Stunde zu sehr einem langen Werbetrailer gleichkommt, während inhaltliche Elemente zurückstehen. Zwar ist August Diehl die perfekte Besetzung als deutsch sprechender Woland, der als eine Art Mephistopheles immer wieder auf den Pakt mit dem Teufel aus Goethes „Faust“ anspielt, indem dieser sich vorstellt als „Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“. Zur Horrorgroteske wird der Streifen, wenn Woland auftaucht und dem Chef einer Literaturzeitschrift prophezeit, er verliere gleich den Kopf unter den Rädern einer Trambahn, und dies kurz darauf auch geschieht.
Dass die im monumentalen Zuckerbäckerstil gestaltete Architektur der Sowjetära, für den Film digital am Computer erschaffen, am Ende in Flammen unterzugehen scheint, mag als Revanche des Schriftstellers Bulgakows gedeutet werden, der in seinen letzten Jahren nicht mehr publizieren durfte. Sein Verhältnis zur Staatsmacht blieb ambivalent. Um überhaupt arbeiten zu können, musste er sich arrangieren. Ähnlich geht es den Menschen im Russland der Gegenwart, denen es kaum noch möglich ist, Kritik zu äußern. Dem Film wie auch der literarischen Vorlage ist es gelungen, den Totalitarismus zu entlarven. Er erinnert die Menschen in Russland an den eigenen Alltag und ermöglicht es ihnen, diesem zumindest für zweieinhalb unterhaltsame Stunden zu entfliehen.
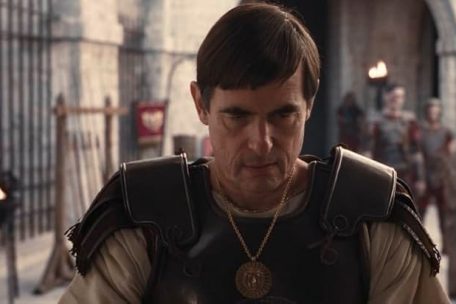

 De Maart
De Maart









Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können