Der am 23. Dezember 1932 in Düsseldorf als ältestes von zwei Kindern eines jüdischen Paars, Berthold und Ruth Klestadt, geborene Gerd, schildert die ersten Jahre seiner „Kindheit in schwierigen Zeiten“ (so der Titel des ersten Kapitels) wie folgt: „Die Voraussetzungen für eine sorglose und wohlbehütete Kindheit waren zunächst gegeben“, so Klestadt. Doch es war eine „chaotische und gefährliche Zeit, in der sich die Ereignisse nur so überstürzten“. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten kam eine Katastrophe auf Deutschland zu.
Als die rassistische Diskriminierung der Juden immer stärker wurde, floh die kleine Familie Anfang 1937 ins niederländische Exil. Die Familie – mittlerweile war sein knapp drei Jahre jüngerer Bruder Peter geboren – fand in Scheveningen, einem Stadtteil von Den Haag, vorübergehend eine neue Heimat. Doch kurz nach der Besetzung der Niederlande durch die deutsche Wehrmacht im Jahr 1940 setzte auch dort die Judenverfolgung durch die Nazis ein. Wieder musste die Familie fliehen. Sie konnte sich zwar bei einer Familie verstecken, wurde jedoch durch Nachbarn verraten und im Februar 1943 verhaftet. Über das Durchgangslager Westerbork deportierten die Schergen des Nazi-Regimes sie im Februar 1944 in das Konzentrationslager Bergen-Belsen in Niedersachsen. Klestadts Großmutter wurde in das Vernichtungslager Sobibor deportiert und dort kurz nach ihrer Ankunft ermordet. Sein Vater starb in Bergen-Belsen an Entkräftung. Klestadt konnte das Lager zusammen mit seiner Mutter und Bruder Peter am 7. April 1945 in Richtung Theresienstadt verlassen. Sie wurden befreit und kehrten schließlich in die Niederlande zurück.
Familie fällt Nazis zum Opfer
Ein großer Teil seiner Familie wurde in den Konzentrationslagern der Nazis ermordet. Nach einer langen, schmerzhaften Zeit der Verdrängung und Depression begann Klestadt mit Hilfe einer Trauma-Therapie, seine Lebensgeschichte aufzuarbeiten. Unter anderem in Luxemburg, Deutschland und Frankreich trat er als Zeitzeuge in Schulen auf. Die Geschichte seiner Familie steht stellvertretend für die der sechs Millionen Menschen, die der Judenverfolgung Hitler-Deutschlands zum Opfer gefallen sind und ermordet wurden. Seine Botschaft ist eine humanistische und zugleich eine Mahnung.
In dem Buch beschreibt Klestadt sowohl Flucht und Verfolgung, begleitet von Ausgrenzung und Entrechtung, etwa durch die Nürnberger Gesetze von 1935, Enteignung und Demütigung durch den Judenhass in der Bevölkerung und der ständigen Furcht, verhaftet und verschleppt zu werden. Und er schildert den grausamen Alltag im Konzentrationslager: Die schwere körperliche Arbeit bis zur Erschöpfung, der ständige Hunger und die schlechten hygienischen Bedingungen schwächten die Lagerinsassen. Vor allem Fleckfieber und Typhus gingen in dem KZ um. Am 4. Februar 1945 wachte der damals Zwölfjährige neben seinem toten Vater auf. Es war die traumatischste Erfahrung für ihn. „Auch die acht Jahrzehnte, die seitdem vergangen sind, können diese Wunde nicht heilen“, so Gerd Klestadt. „Seit unserer Ankunft im Lager hatten wir Körper an Körper geschlafen, um uns unter unseren zwei Decken warmzuhalten. Mein Vater war meine stärkste Bezugsperson. Er hat alles für mich bedeutet.“ Es war das schlimmste Erlebnis, „als ich frühmorgens am 4. Februar meinen Arm ausstreckte, um meinen Vater zu wecken (…) und feststellte, dass er gestorben war“.
Im Lager habe sich niemand um ihn gekümmert oder versucht, ihn zu trösten, erzählt Klestadt. „Jeder war nur auf sich bedacht, es gab keine Solidarität“, sagt er. Die Eltern vieler Kinder waren ermordet worden. Tiefe Einsamkeit prägte sein Leben im KZ. Bergen-Belsen war eines der letzten Konzentrationslager, das befreit wurde. Trotzdem starben noch Hunderte an Typhus. „Wenn ich morgens kam, waren wieder welche tot“, zitiert Kathrin Mess eine Krankenpflegerin. Viele Überlebende seien dem Tod näher als dem Leben gewesen. „Mehr als 10.000 Leichen waren zu hohen Haufen aufgetürmt oder lagen verstreut zwischen den Baracken und unter den Bäumen“, schreibt die Autorin. Auch nach der Befreiung von Bergen-Belsen am 15. April 1945 durch die britische Armee waren die Gefahren nicht vorüber: Klestadt wurde kurz nach seiner Ankunft bei einem Lager für „Displaced Persons“ von einem deutschen Heckenschützen ins Knie geschossen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und musste operiert werden. „Ein großes Loch klaffte in meinem Knie“, sagt er. Die Narbe sei heute noch sichtbar und erinnere ihn jeden Tag an damals.
„Rückkehr ins Leben“
Wie seine Mutter und sein Bruder wurde Gerd Klestadt in die Niederlande zurückgebracht. Wie in anderen Ländern hatten auch dort „angebliche alle Menschen unter der Besatzung gelitten“, heißt es im Buch, „waren im Widerstand aktiv oder an den Streiks beteiligt gewesen. Über alles andere wurde nicht gesprochen“. Diese kollektive Geschichte wurde lange aufrechterhalten. Die etwa 4.700 niederländischen Überlebenden kehrten in eine „verkniffene, schweigsame Welt“ zurück. In der Bevölkerung stießen sie auf wenig Anteilnahme. Nach seinem Abitur 1952 begann Klestadt Tropenlandwirtschaft in Deventer zu studieren. Es war eine „Rückkehr ins Leben“, wie es im Buch heißt.
In seiner Studienzeit rückte seine jüdische Vergangenheit, sein „Jüdischsein“, ins Zentrum seines Denkens. „Ich bin als Jude ins Konzentrationslager gekommen und wollte mir meine Religion nicht nehmen lassen“, sagt er. „Ohne Bar Mitzwa fühlte ich mich unvollständig.“ Die Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinschaft erfüllte ihn mit Stolz. Ihn zog es nach Israel. Während in den 1950er und 1960er Jahren in Deutschland wie in den Niederlanden so gut wie nicht über den Holocaust gesprochen wurde, „war (und ist) das Thema in Israel zentral“. Er arbeitete in einem Kibbuz, seine Mutter fuhr regelmäßig nach Israel und engagierte sich in den Kinderheimen der Kibbuzim.
1955 kehrte Klestadt in die Niederlande zurück, um sein Studium zu beenden, und ließ sich anschließend in Honduras zum Bananen- und Viehexperten ausbilden. Nach seiner Rückkehr wechselte er die Branche und bewarb sich bei dem Büromaschinenhersteller Olivetti. Für den neuen Arbeitgeber ging er 1959 nach Johannesburg, wo er seine erste Frau kennenlernte, mit der 1961 eine Tochter bekam. Die Ehe wurde zwei Jahre später wieder geschieden. 1970 lernte Klestadt seine zweite Frau Charlene kennen, die er im August desselben Jahres in Johannesburg heiratete. Charlene unterrichtete an einem Gymnasium und engagierte sich gegen die Apartheid. Im Haus der Klestadts gingen Mitglieder des African National Congress (ANC) ein und aus. Die Situation für die Apartheid-Gegner wurde allmählich zu gefährlich, sodass Charlene und Gerd Klestadt das Land verließen und 1973 nach Luxemburg zogen.
Der Tod ist für mich ein Trauma. Ich kann dem Tod nicht in die Augen sehen.
Warum ins Großherzogtum? Nach Deutschland zu ziehen, sei für ihn nie eine Option gewesen. Zahlreiche NS-Täter waren längst wieder in die bundesdeutsche Gesellschaft integriert, bewegten sich dort ohne Schuldbewusstsein und gingen ihren Karrieren nach. Luxemburg war dagegen ein sicheres Land, „klein und übersichtlich“, sagte Gerd Klestadt in einem Interview mit der Revue vor zehn Jahren, „und ich kannte hier einige Leute, wie zum Beispiel den damaligen Wirtschaftsminister Marcel Mart“. 1973 wurde Tochter Deborah geboren, drei Jahre später Carmella. 1987 erhielt die Familie die luxemburgische Staatsbürgerschaft.
Unbewältigte Traumata
Nach dem Tod seiner Mutter setzte für Klestadt erneut eine schwere Zeit ein. Sie war für ihn eine wichtige Gesprächspartnerin, nur mit ihr habe er über die schrecklichen Erlebnisse von Bergen-Belsen reden können. Viele verdrängte Erinnerungen seien hochgekommen und überwältigten ihn. Klestadt konnte nachts nicht mehr schlafen. Immer wieder schaute er sich Filme über den Holocaust an. „Ich habe in meinem Leben zu viele Tote gesehen“, sagt er. „Der Tod ist für mich ein Trauma. Ich kann dem Tod nicht in die Augen sehen.“
Nach einer langen, schweren Zeit und einer Therapie, die ihm half, wieder Lebensmut zu fassen, ging er in Schulen, um als Zeitzeuge über den Holocaust zu sprechen, oder begleitete Klassen zu Gedenkstätten. Für seine Erinnerungsarbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem René-Oppenheimer-Preis. Der mittlerweile 92-Jährige lebt in Longwy. Nach dem kürzlichen Tod seiner Frau Charlene ist er wieder auf sich allein gestellt. Lange hat er unermüdlich an seiner Mission festgehalten, den Menschen etwas mitzuteilen und über den Holocaust aufzuklären. „Es ist die Pflicht meiner Erinnerung“, sagt er. „Manchmal bin ich verzweifelt und weiß nicht, wie es weitergehen soll mit dieser Welt. Überall gibt es wieder Krieg und Totschlag, Mord und Vergewaltigungen. Deshalb erzähle ich euch meine Geschichte.“ Sie soll dabei helfen, „die Welt zu einem besseren Ort zu machen“. Am Ende seiner Vorträge verteilt Gerd kleine bunte Glasmurmeln für seine Zuhörer. Niemand solle seinen Vortrag ohne Murmel verlassen. Sie steht dafür, „dass wir in Zukunft in einer Welt ohne Hass, ohne Fremdenfeindlichkeit und ohne Rassismus leben sollten, in einer Welt, in der wir alle friedlich zusammenleben können“.

 De Maart
De Maart







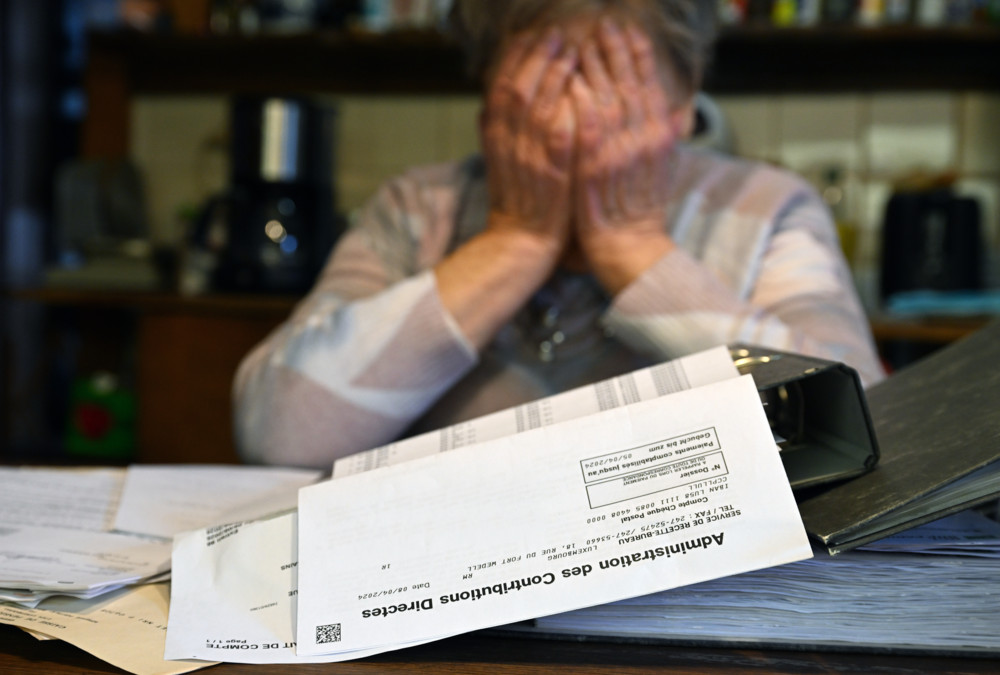

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können