Es sind schlechte Zeiten für die politische Linke. Mal wieder. Fast überall. Im vergangenen Oktober haben die Luxemburger Wähler nach zehn Jahren ein linksliberales Regierungsbündnis abgestraft. Um die deutsche Ampelkoalition steht es auch nicht sonderlich gut, bei den ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst droht der Super-GAU: eine jüngste Umfrage sieht die AfD in Sachsen bei 37 Prozent, die SPD flöge mit drei Prozent gar aus dem Landtag. Im Juni geht ganz Europa an die Wahlurnen, auch hier deuten die Prognosen auf einen Rechtsruck hin. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten, Donald Tusk hat in Polen die rechtskonservative PiS-Herrschaft beendet, nur ist der beileibe kein Linker. Und in den Niederlanden wurden kurz danach Rechtspopulist Geert Wilders und seine PVV stärkste Kraft im Parlament.
Die Zukunft des linken, progressiven Lagers in Europa, gar in der westlichen Welt (Hallo, Trump 2024) sieht recht düster aus. Man könnte meinen: Die Leute wollen keine linke Politik, die Leute wählen keine linke Politik. Aber ganz so einfach ist es nicht. Die Situation ist komplexer – und einigermaßen paradox. Denn an sich sind linke Ideen im sogenannten Westen so verbreitet wie lange nicht.
Linke Investitionspolitik, rechte Migrationspolitik
In der Wirtschaftspolitik vieler Länder lässt sich eine Hegemonie linker Ideen feststellen. Ökologische Transformationsprozesse werden vom Staat gelenkt und vorangetrieben. In Deutschland arbeitet der grüne Wirtschaftsminister daran, Industriestandorte zu erhalten, indem sie klimaneutral umgestaltet werden. Mit Unterstützung des Bundes soll beispielsweise die saarländische Stahlindustrie in Zukunft „grünen“, CO2-freien Stahl produzieren. Auch in den USA, einem Land, in dem staatliche Eingriffe in die Wirtschaft einst sofort unter Sozialismusverdacht standen, steckt Präsident Biden viel Geld in geförderte Transformationsprogramme.
In Luxemburg haben „déi gréng“ einen zukunftsweisenden Mobilitäts- und Infrastrukturplan auf Straße und Schiene gestellt. Aber linke Ideen spiegeln sich nicht nur in staatlichen Großprojekten wider. Auch die Gesellschaften selbst haben sich verändert, sie sind emanzipatorischer und liberaler geworden. Was Werte anbelangt, finden sich ehemals konservative Positionen nicht einmal mehr in den Parteiprogrammen konservativer Parteien. Die deutsche CDU hat kürzlich einen Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm vorgelegt. Dort wird die Ehe nicht mehr als Gemeinschaft von Mann und Frau definiert, sondern als Gemeinschaft von zwei Menschen. Hierzulande hat sich die CSV die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren im Adoptionsrecht ins Regierungsprogramm geschrieben.
Warum scheint die Debattenlandschaft dennoch überall in Europa nach rechts zu rutschen? Weil mit der Migrationspolitik eines der zentralen Politikfelder der Gegenwart von rechten Positionen dominiert wird – bis weit ins linke Lager hinein. In Brüssel hat man sich kurz vor Jahresende auf eine grundlegende Verschärfung der europäischen Migrationspolitik geeinigt. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, „endlich im großen Stil abschieben“ zu wollen. Kurz vor Weihnachten hat der französische Präsident Emmanuel Macron ein neues Einwanderungsgesetz durchgeboxt, das von vielen als immenses Zugeständnis an Marine Le Pen und ihr Rassemblement National kritisiert wird. Auch der luxemburgische Premier Luc Frieden hat im Neujahrsinterview kürzlich den Klassiker der strengen Worte gewählt: Luxemburg könne nicht jeden aufnehmen. „Unser Sozialsystem schafft das nicht, unsere Krankenhäuser schaffen das nicht.“
Es ist klar, dass es sich hierbei um die Versuche konservativer, liberaler, sozialdemokratischer Politiker handelt, weitere rechte und antidemokratische Erfolge zu verhindern. Premier Frieden lässt daran keinen Zweifel. Ebenso klar ist aber auch, dass diese Strategie nicht aufgeht. Das hat Wahl um Wahl bewiesen. Am Ende wählen die Leute das Original. Nicht das Schaf im Wolfspelz. Was also bleibt den demokratischen Kräften, allen voran den linken Parteien?
Ein Ratschlag, der immer wieder zu hören ist: Die Linke müsse sich auf ihre Kerntugenden berufen, auf die soziale Frage, gesellschaftliche Ungerechtigkeit, die Schere zwischen Arm und Reich. Und genau da lauert schon das nächste Paradoxon.
Linke Kritik, ja – linke Politik, nein
Die deutschen Forscher Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser haben im vergangenen Jahr eine groß angelegte makrosoziologische Studie zur deutschen Gesellschaft und ihren Konfliktthemen veröffentlicht („Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft“). Ihre Ergebnisse beziehen sich zwar ausschließlich auf die Bundesrepublik, einige Punkte sind aber auch mit Blick auf West- und Mitteleuropa erhellend. Ein zentraler Befund von Mau und Kollegen: In der Gesellschaft herrscht ein breiter Konsens über die ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen. Unabhängig von ihrem eigenen Status sehen die meisten Menschen eine größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. Sie teilen also linke Ungleichheitskritik. Allein: Die Zustimmung zu linker Kritik übersetzt sich nicht in die Zustimmung zu linker Politik. „Während die allermeisten Ungleichheit ablehnen, scheiden sich die Geister an staatlichen Eingriffen, die den Reichen nehmen und den Armen geben“, schreiben Mau, Lux und Westheuser.
Warum können linke Parteien im Angesicht der wachsenden Ungleichheit nicht mobilisieren? Und warum profitieren stattdessen oft rechte Parteien? Laut Mau, Lux und Westheuser liegt das an der relativen Demobilisierung der von ihnen so bezeichneten „Oben-Unten-Arena“: „Kritik an Ungleichheit wird von einem Glauben an Leistungsethos und Meritokratie konterkariert, der im Unten wie im Oben Tendenzen der Entsolidarisierung befördert.“ Produktionsarbeiter und Geringverdiener treten nach unten, auf horizontaler Ebene entsteht ein „moralisierter Konkurrenzkampf“, bei dem um verdiente oder unverdiente Sozialleistungen, Faulheit und Sozialschmarotzertum gestritten wird. In den oberen Gesellschaftsschichten zeichnet sich die Entsolidarisierung dadurch aus, dass Wohlhabende eher auf „individualisierte Statusstrategien“ wie zum Beispiel Immobilienkauf zurückgreifen, um die eigene Zukunft und die ihrer Kinder abzusichern, anstatt an kollektive Solidaritätsformen wie Steuern zu glauben. Die Soziologen sprechen im Rückgriff auf Klaus Dörre von einer „demobilisierten Klassengesellschaft“, in der der Klassenkampf des 20. Jahrhunderts von einem Wettbewerb der Individuen überlagert wird.
Innen und Außen statt Oben und Unten
Paradoxerweise, das zeigen international vergleichende Studien, gehen wachsende Verteilungsungleichheiten mit einem zunehmenden Glauben an das Leistungsprinzip und die Verantwortung des Individuums einher. Ein Paradoxon, auf das keine linke Partei eine Antwort hat.
Ebenso wenig die politische Rechte. Ihnen ist aber etwas anderes gelungen: die Umlenkung der Klassenfrage. In ihrem Weltbild geht es nicht mehr um Verteilungskonflikte zwischen einem Oben und Unten in der Gesellschaft, sondern zwischen „Innen“ und „Außen“, zwischen Einheimischen und Einwanderern. Rechte Parteien haben die soziale Frage erfolgreich gekapert und verdreht. Auch deshalb konnte Migrationspolitik zu einem der entscheidenden politischen Konflikte der Gegenwart werden.
Was bleibt der Linken noch, wenn traditionelle Themenfelder entweder nicht mobilisieren bzw. so umgedeutet wurden, dass sie nicht mehr bespielbar sind, ohne die eigene politische Identität aufzugeben? Sie muss die Definitionshoheit über die soziale Frage zurückgewinnen – und sie in die Gegenwart übersetzen. Ein luxemburgisches Beispiel wäre die Wohnungskrise. Seit Jahren arbeitet die ADR daran, dieses Problem vom Oben-Unten-Konflikt zum Innen-Außen-Konflikt umzudeuten, Logement als Migrationsproblem. Die politische Linke täte gut daran, diesen Versuch zu unterbinden.
Das größte Potenzial für die Linke liegt hingegen in der Klimafrage. Wie Mau, Lux und Westheuser analysieren, wurden ökologische Auseinandersetzungen in der Vergangenheit vor allem als Wertekonflikt gelesen. Kulturkampf statt Klassenkampf. Spätestens seit den Protesten der „Gilets jaunes“ wird deutlich, dass ökologische Konflikte eine zunehmend soziale Dimension haben. Die Studie von Mau, Lux und Westheuser zeigt auf, dass gerade die unteren Schichten am stärksten von ökologischen Transformationsprozessen betroffen sind – gleichzeitig haben sie den geringsten CO2-Fußabdruck. „Unter der Oberfläche einer gesellschaftlich geteilten Sorge um die Erderwärmung“, schreiben Mau und Kollegen, „liegen stark auseinanderlaufende Verantwortungen, Betroffenheiten und Interessen, welche die Basis für einen intensivierten Konflikt entlang von Klassenzugehörigkeiten darstellen können.“ Ihre Prognose: Die ökologische Frage wird sich zunehmend als Klassenfrage stellen. Und mit Klassenfragen kennt sich die Linke bekanntlich aus.

 De Maart
De Maart
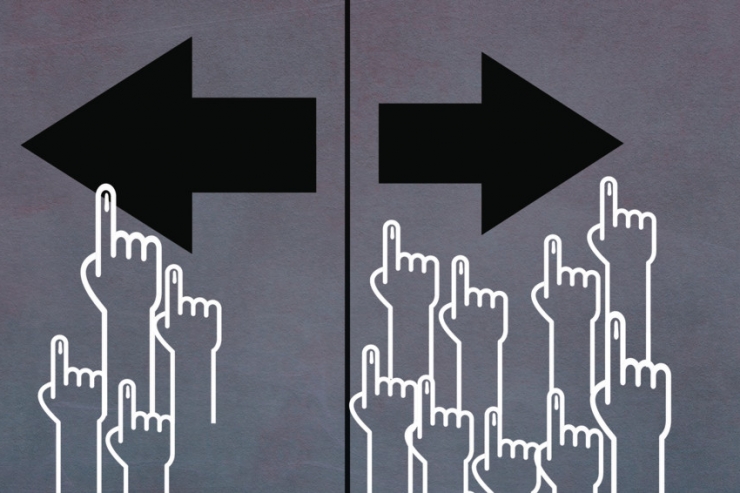






Nach Sarah Wagenknecht ist fuer die Lifstyle Linke die korrekte Anwendung des Gendersternchen wichtiger als der Mindestlohn .Was hat die oekologische Transition mit linker Politik zu tun ? Allein der Bruesseler Ukas bis 2035 aus dem Verbrennermotor auszusteigen ,wird hundertausende Arbeitsplaetze kosten .
Die deutsche ampel soll links sein?
Mit einer neoliberalen FDP welche unsern Xavier fast als linken revoluzzer erscheinen laesst,einer gruenen aussenministerin welche die rechtsextreme netanyahu regierung in Istael hofiert und einem kanzler, wo man oft nicht richtig weiss wo er steht.
Mit der AFD kann es auch nicht viel rechter kommen.
"Viele Menschen teilen linke Kritik an einer ungerechten Gesellschaft. Und wählen trotzdem rechte Parteien. Warum?"
Ganz einfach: Nach jahrelangem Mitregieren von "Links"-parteien haben die Wähler gemerkt, dass von dort nichts Besseres herauskommt. Die Anzahl der armen Bettler ist drastisch gestiegen. Reiche Kaviarsozialisten mit RollsRoyce schenkten sich und den Baulöwen sehr hohen Profit. Indexmanipulationen wurden angedacht und die Renten waren auch nicht mehr unantastbar. Ehrlich: es ist besser wenn die sogenannten Linksparteien in der Opposition sitzen. Dort sind sie nämlich erstaunlich sozial.