Zwei südamerikanische Spitzenfunktionäre (der Paraguayer Carlos Leoz und der Brasilianer Ricardo Teixeira) und ein hochrangiger Offizieller aus Afrika (Issa Hayatou aus Kamerun), die am Donnerstag über die Gastgeber der WM-Turniere 2018 und 2022 mitbestimmen, sollen nach übereinstimmenden Medienberichten in der Vergangenheit Bestechungsgelder angenommen haben.
Am Dienstag reagierte der südamerikanische Verband Conmebol auf die Korruptionsvorwürfe gegen seinen Präsidenten Nicolás Leoz. Die Beschuldigungen hätten „keine Grundlage“, sagte Conmebol-Sprecher Néstor Benítez.
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) wird die Vorwürfe gegen den afrikanischen Spitzenfunktionär untersuchen, der in der Vergangenheit Bestechungsgelder von der ehemaligen FIFA-Vermarktungsagentur ISL (siehe Kader, d. Red.) angenommen haben soll.Siehe auch:
WM-Vergabe wird zur Farce
Beide Vergaben: Morgen
Die FIFA hat am Dienstag noch einmal mitgeteilt, dass beide Weltmeisterschaften (2018 und 2022) am Donnerstag vergeben werden. Die Anti-Korruptions-Organisation hatte gefordert, die WM 2022 zu einem späteren Zeitpunkt zu vergeben, „bis endgültig Licht in die Vorwürfe gebracht ist, die derzeit in den Zeitungen stehen“.
Aber auch vom englischen TV-Sender BBC fordert das IOC Beweise. Die BBC hatte am Montagabend in ihrer Sendung „Panorama“ über eine Verwicklung der FIFA-Exekutivmitglieder berichtet.
Aus IOC-Kreisen soll zudem nach Angaben der Süddeutschen Zeitung Lamine Diack von der seit 2001 bankrotten Vermarktungsagentur geschmiert worden sein. Das senegalesische IOC-Mitglied ist Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF.
Aussitzen statt aufklären
Die FIFA zeigt derweil eine andere Haltung als das IOC und hat das Dossier bereits ad acta gelegt: „Die Untersuchungen in diesem Fall sind abgeschlossen“, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes mit Verweis auf die damaligen Ermittlungen der Schweizer Behörden. „Im Urteil des Gerichtes in Zug vom 26. Juni 2008 ist kein FIFA-Offizieller wegen krimineller Handlungen verurteilt worden.“ Die Reaktion wirft ein schlechtes Licht auf den Weltverband und Sepp Blatter. Der hatte nach der letzten Korruptionsaffäre erklärt, dass neue Fälle ausgeschlossen seien. Claudio Sulser, Chef der Ethik-Kommission, spricht von einem riesigen Imageverlust. Joseph Blatter muss sich vor allem den Vorwurf gefallen lassen, mit zweierlei Maß zu messen.
Im Fall der suspendierten Exekutivmitglieder Temarii und Adamu gab er sich als tatkräftiger Aufklärer, während er diesmal die Ermittlungen blockiert. Warum das so ist, liegt auf der Hand: Bei den drei neuen Beschuldigten handelt es sich um Schwergewichte des internationalen Fußballs, während Temarii und Adamu nur „Hinterbänkler“ waren.
In der Schweiz wird mit reichlich Verspätung offenbar ein Gesetz gegen bestechliche Funktionäre ausgearbeitet. Ranghohe Funktionäre von in der Schweiz ansässigen Sportverbänden wie der FIFA, der UEFA oder dem IOC müssen bei Korruptionsverdacht derzeit nicht mit Strafverfolgungen rechnen. In der Schweiz ist man allerdings sehr froh darüber, die FIFA beheimaten zu dürfen. Das dürfte auch der Grund sein, warum es bislang zu keiner Änderung der Gesetzeslage kam.
Die Transparency Schweiz hatte die FIFA aufgefordert, die WM-Vergabe zu vertagen, bis die Anschuldigungen geklärt sind. Die Untersuchung müsse von einem unabhängigen Gremium durchgeführt werden. Dieser Aufforderung kommt der Weltverband jedoch nicht nach. Am Dienstag bestätigte deren Generalsekretär Jérôme Valcke, dass beide WM-Turniere wie geplant am Donnerstag vergeben werden.
Die ISL und die Zahlungen
Die ehemalige FIFA-Vermarktungsagentur ISL ging 2001 bankrott. Dem Fußball-Weltverband FIFA entstand dadurch ein finanzieller Schaden in Höhe von 51 Millionen Schweizer Franken. Die ISL hatte die außereuropäischen TV-Rechte für die Weltmeisterschaften 2002 und 2006 für 1,4 Milliarden Franken erworben. Laut FIFA- Präsident Sepp Blatter konnte der Verlust durch größere Vermarktungseinnahmen als erwartet später auf 36,9 Millionen Franken begrenzt werden.
Bereits 2008 sind während des Strafprozesses gegen die ISL Zahlungen an Funktionäre der FIFA, des IOC und anderer Verbände in Höhe von 138 Millionen Franken publik geworden. Diese Zahlungen sollen zwischen 1989 und 2001 über eine Stiftung in Liechtenstein geflossen sein. Damit hatte sich die ISL offenbar lukrative Marketingrechte gesichert.

 De Maart
De Maart





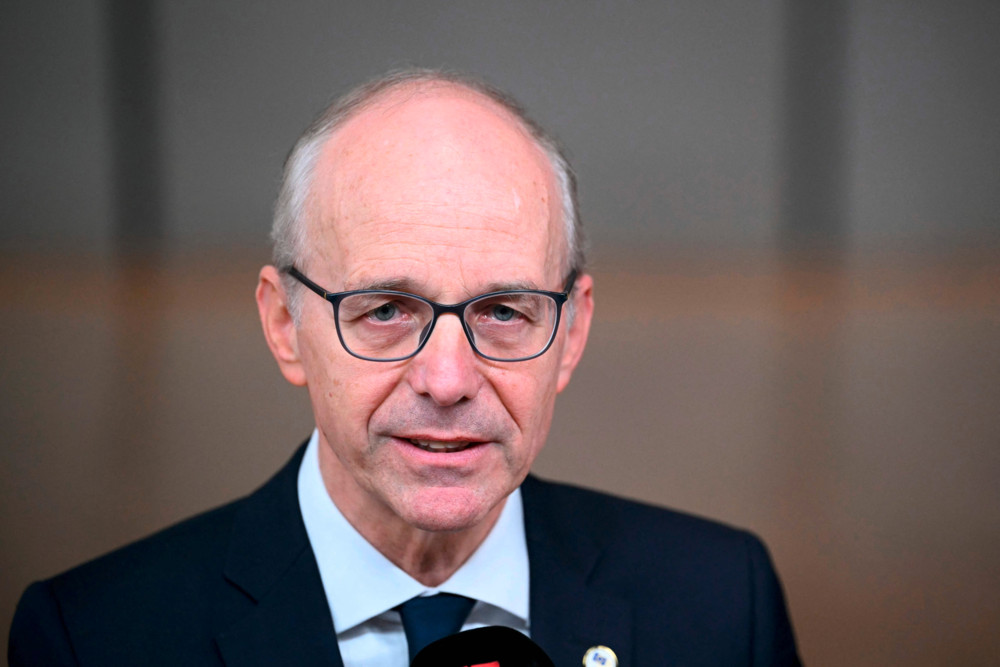

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können