Die lange blockierte Reform des Eurorettungsfonds ESM kommt in Fahrt. Das Finanzinstitut, das in Luxemburg seinen Sitz hat und von dem Deutschen Klaus Regling geleitet wird, soll mehr Kompetenzen erhalten und künftig auch marode Banken absichern. Dies beschloss die Eurogruppe, nachdem Italien seinen Widerstand aufgegeben hatte. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sprach von einem Durchbruch.
„Dieser Einigung kommt strategische Bedeutung zu“, sagte Le Maire. Die Eurozone werde nun das „am besten geschützte“ Währungsgebiet der Welt. Durch die Reform würden sowohl die Staaten als auch die Banken besser abgesichert. Auch der deutsche Finanzminister Olaf Scholz zeigte sich erfreut. „Wir machen die Eurozone noch robuster gegenüber den Attacken von Spekulanten“, so Scholz.
Allerdings gilt der nun geplante „Backstop“ für Pleite-Banken erst ab Anfang 2022 – womöglich zu spät für die Krise, die die Euro-Währungsunion derzeit durchläuft. Denn schon bald könnten europäische Finanzinstitute in Schieflage geraten, wie der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt. Der „Backstop“ sieht vor, dass der ESM einspringt, wenn dem Bankenabsicherungsfonds SRF das Geld ausgeht.
Mit der Reform könne das Sicherheitsnetz für die Banken auf 68 Milliarden Euro anwachsen, sagte Le Maire. Insgesamt verfügt der „European Stability Mechanism“ über ein Kreditvolumen von 500 Milliarden Euro. Damit kann er sich mit dem neuen Corona-Aufbaufonds messen, der bis zu 750 Milliarden Euro erhalten soll. „Die EU schützt doppelt vor der Krise“, freute sich der Franzose.
Kein Nutzen in der Corona-Krise
Kritisch äußerte sich dagegen der Europaabgeordnete Sven Giegold. „Der Backstop ist zu klein, zu unpraktisch, zu unverbindlich“, sagte der grüne Finanzexperte. Viel Glaubwürdigkeit werde dadurch verspielt, dass jeder Einsatz erst vom Großteil der Eurogruppe genehmigt werden muss. Im Ernstfall würden die Finanzmärkte so weiter auf die Pleite von Banken wetten, befürchtet Giegold.
Es gibt aber noch ein anderes Problem: Die seit 2012 geplante Bankenunion ist mit der nun beschlossenen Reform immer noch nicht vollendet. Es fehlt ein zentraler Baustein – die gemeinsame Einlagensicherung. Auch das Ziel, den ESM zu einem europäischen Währungsfonds weiterzuentwickeln, wurde verfehlt.
Das Luxemburger Institut übernimmt zwar einen Teil der Kontrollaufgaben in der Finanzpolitik, die bisher die EU-Kommission in Brüssel ausgeübt hat. Doch mit dem IWF kann es sich auch künftig nicht messen. Zuletzt waren sogar Zweifel am Nutzen des ESM aufgekommen. Vor allem in Rom dachte man laut über ein Ende des Rettungsfonds nach. Der Grund: In der Corona-Krise hat sich das Luxemburger Institut bisher nicht bewährt. ESM-Chef Regling bot zwar frische Kredite zu günstigen Konditionen und fast ohne Auflagen an, was einen Bruch mit der bisher rigiden Vergabepolitik bedeutete. Doch niemand wollte diese Corona-Kredite haben – denn sie hätten die ohnehin hohe Verschuldung in Krisenländern wie Italien weiter erhöht. Zudem gelten ESM-Hilfen seit der Eurokrise in vielen Hauptstädten als „toxisch“ – wer sie annimmt, gesteht sein eigenes Scheitern ein.

 De Maart
De Maart

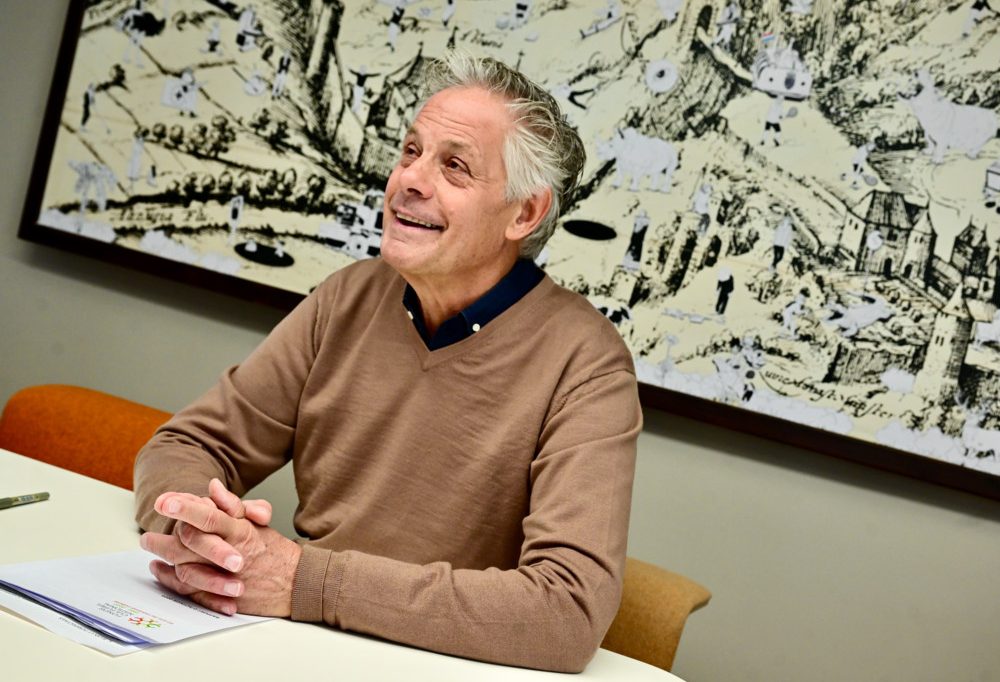





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können